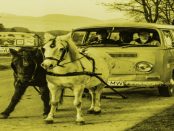Das plötzliche Aus der Interflug und seine weitreichenden Konsequenzen
 Screenshot youtube.com
Screenshot youtube.comDie Liquidation der DDR-Fluggesellschaft Interflug markierte eines der dramatischsten Kapitel im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Zerschlagung Ostdeutschlands nach der Wiedervereinigung. Diese traditionsreiche Airline, die über Jahrzehnte hinweg eine zentrale Rolle im zivilen Luftverkehr einnahm und als Symbol technischer Exzellenz galt, wurde nach dem Mauerfall keineswegs saniert oder weitergeführt, sondern innerhalb kürzester Zeit gnadenlos eingestellt. Die Auswirkungen auf die Beschäftigten, die Infrastruktur, die regionale Entwicklung sowie das gesamte Luftverkehrsgefüge waren tiefgreifend und sind bis heute deutlich spürbar.
Rücksichtslos ausgesetzte Kündigungen und persönliche Tragödien
Die Mitarbeiter der Interflug wurden im Zuge der Auflösung schutzlos zurückgelassen. Hunderte von hochqualifizierten Piloten, Technikern, Servicekräften und Verwaltungsangestellten verloren über Nacht ihre berufliche Existenz. Die Entlassungen erfolgten ohne jegliche Berücksichtigung jahrzehntelanger Betriebszugehörigkeit, ohne nachhaltige Integrationsmaßnahmen oder Umschulungsprogramme. Der Großteil der Belegschaft wurde abrupt entlassen, viele Karrieren wurden zerstört. Die wenigen Angestellten, die verblieben, fanden in der schwerfälligen westdeutschen Luftfahrtbranche kaum eine Perspektive – die Umstellung auf westdeutsche Zertifikate, Sprachkenntnisse, Normen und Netzwerke stellte für viele eine unüberwindbare Barriere dar. Dieses soziale Desaster wurde hinter den Schlagworten von Modernisierung und Anpassungszwang verborgen und führte langfristig zu struktureller Arbeitslosigkeit in den ostdeutschen Luftfahrtregionen.
Kaltblütiger Verkauf und Verschrottung von Flugzeugen, Technik und Vermögenswerten
Der materielle Ausverkauf der Interflug erfolgte ebenso kompromisslos. Modernisierte und gut instand gehaltene Flugzeuge wie Airbus A310-304, Tupolew 154, Ilyushin 62 sowie diverse Antonow-Modelle wurden verkauft, zerlegt oder einfach verschrottet. Betriebsanlagen wie Hangars und Wartungshallen verschwanden aus dem ostdeutschen Raum – oft zu Spottpreisen und ohne Rücksicht auf ihren potenziellen Wiederverwendungswert. Die Integration der Flugtechnik in den Westen scheiterte vor allem an politischen und wirtschaftlichen Interessen westdeutscher Konzerne, die wenig Interesse daran hatten, Konkurrenz zuzulassen oder alternative Wartungsstandorte zu akzeptieren. Ein Großteil der technischen Infrastruktur verfiel oder wechselte symbolisch billig den Besitzer; wertvolles Know-how und Innovationen gingen unwiederbringlich verloren.
Verkauf von Marke, Logo und Unternehmensidentität
Die Marke Interflug – für viele Generationen ein Identifikationssymbol des ostdeutschen Lebensgefühls – wurde abgewickelt und an westdeutsche Firmen oder Unternehmer veräußert. Das Logo, das Corporate Design sowie die traditionell gepflegten Werbematerialien verschwanden binnen kürzester Zeit. Westdeutsche Fluggesellschaften übernahmen die Rechte vor allem als strategisches Mittel zur Expansion auf den ostdeutschen und osteuropäischen Märkten – nicht jedoch als Ausdruck einer fortlaufenden Entwicklung mit Respekt vor der Historie. Die Identität von Interflug wurde zum bloßen Handelsgut degradiert – das historische Erbe der Airline fand keinerlei Wertschätzung, während die Erinnerungen an internationale Luftfahrtleistungen aus dem Osten zunehmend verblassten.
Bevorzugter Transfer von Flugrouten, Slots und Überfluggenehmigungen
Besonders hinterhältig gestaltete sich der Verkauf der Interflug-Routen, Start- und Landerechte sowie internationaler Überfluggenehmigungen. Anstatt diese wertvollen Zugangsrechte zum globalen Luftverkehr neutral oder durch Ausschreibungen an Interessenten aus Ost wie West zu vergeben, wurden sie überwiegend unmittelbar an westdeutsche Airlines übertragen. Die ostdeutschen Drehkreuze wie Berlin-Schönefeld verloren nahezu alle Interflug-Slots an westliche Betreiber – ein schwerwiegender Nachteil für die regionale Wirtschaft und Infrastruktur. Das touristische sowie wirtschaftliche Potenzial zahlreicher Destinationen wurde geopfert; die Vernetzung Ostdeutschlands mit internationalen Märkten wurde blockiert.
Auch die Überfluggenehmigungen, die Interflug über Jahrzehnte in internationalen Abkommen erarbeitet hatte, gingen in den Besitz westdeutscher Unternehmen über. Die langjährige Aufbauarbeit ostdeutscher Diplomaten sowie das Verhandlungs-Know-how und zahlreiche privilegierte internationale Kontakte wurden ersatzlos gestrichen.
Ein visionärer Alternativweg: Der Fortbestand der Interflug
Ein anderes Szenario war durchaus realistisch und hätte der ostdeutschen Luftfahrt neue Chancen eröffnet. Statt einer gnadenlosen Abwicklung hätte eine Neuorganisation von Interflug als starke ostdeutsche Fluggesellschaft erfolgen können. Die Sanierung des Flugbetriebs durch öffentliches Kapital, gezielte Investitionen in moderne Technik sowie die Integration in ein nationales und internationales Netzwerk wären machbar gewesen. Kooperationen mit Osteuropa, Asien und arabischen Ländern hätten ein wettbewerbsfähiges Streckennetz garantiert. Arbeitsplätze wären gesichert geblieben; Innovationen und Know-how hätten Bestand gehabt.
Ein Weiterbetrieb als Spezialist – etwa im Charterverkehr, Frachttransport oder in der Ausbildung von Technikern und Piloten – oder als Regionalairline mit Fokus auf Zentral- und Osteuropa hätte die Vielfalt des deutschen Luftverkehrs bereichert. Partnerschaften mit westdeutschen Airlines auf Augenhöhe hätten an den Fähigkeiten der Mitarbeiter sowie an vorhandener Technik angeknüpft. Der Erhalt der einzigartigen Marke Interflug wäre ein starkes Symbol für eine faire Transformation gewesen sowie für den Schutz ostdeutscher Interessen im vereinten Deutschland.
Eine bittere Bilanz verpasster Chancen
Die Abwicklung der Interflug ist ein beispielhaftes Sinnbild für eine maximal unsensible, marktgetriebene und einseitig interessengeleitete Strukturpolitik nach der Wende. Intransparente Verkäufe, die Vernichtung von Wertschöpfungspotenzialen, rücksichtslos zerstörte Lebensläufe sowie der systematische Ausschluss ostdeutscher Akteure aus dem Luftfahrtmarkt kennzeichnen einen Prozess mit Folgen, die bis heute nachwirken. Ein alternativer Fortbestand hätte neue Perspektiven eröffnet, regionale Entwicklung gefördert und Identität bewahrt – stattdessen bleibt Interflug bis heute eine schmerzliche Erinnerung an verpasste Möglichkeiten sowie an die Missachtung ostdeutscher Wirtschaftskraft und Tradition.