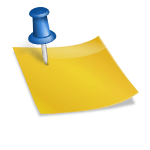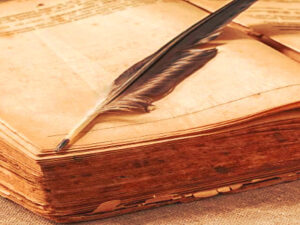Wie gestaltet sich die technische Analyse von Aktien im Kontext der Börse?
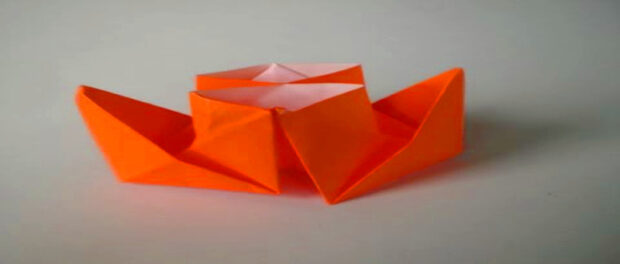 Screenshot youtube.com
Screenshot youtube.comDie Technische Aktienanalyse, auch als Chartanalyse bekannt, geht auf Charles Dow zurück, der sie im späten neunzehnten Jahrhundert begründete. Ihr zentrales Ziel ist es, aus den historischen Kurs- und Umsatzzahlen Prognosen über die zukünftige Kursentwicklung von Wertpapieren abzuleiten. Dow war überzeugt, dass Finanzmärkte zyklischen Bewegungen folgen und bestimmten Mustern unterliegen, eine Sichtweise, die später von Ralph Nelson Elliott mit der Entwicklung der Elliott-Wellen-Theorie weitergeführt wurde. Die breite Anwendung der Chartanalyse setzte jedoch erst mit dem Aufkommen der Computertechnologie in den achtziger Jahren ein, als immer mehr Anleger Zugang zu leistungsfähigen Analysewerkzeugen erhielten.
Fundamentalanalyse und Chartanalyse im Vergleich
Im Gegensatz zur Technischen Analyse steht die Fundamentalanalyse, bei der Wertpapiere auf Basis betriebswirtschaftlicher Kennzahlen und des wirtschaftlichen Umfelds bewertet werden. Während die Chartanalyse davon ausgeht, dass alle relevanten Informationen bereits im Kursverlauf enthalten sind, betrachtet die Fundamentalanalyse die wirtschaftlichen Grundlagen eines Unternehmens. Diese beiden Ansätze spiegeln unterschiedliche Sichtweisen auf die Funktionsweise der Märkte wider und werden häufig kontrovers diskutiert.
Effizienz der Märkte und wissenschaftliche Kontroversen
Die Technische Analyse basiert auf der Annahme, dass Märkte nicht vollkommen effizient sind. In der wissenschaftlichen Literatur wird daher intensiv über die Wirksamkeit technischer Analyseverfahren gestritten. Studien zu diesem Thema kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen: Während ältere Untersuchungen häufig positive Resultate zeigen, sind neuere Arbeiten oft kritischer und weisen auf methodische Probleme wie Data-Snooping oder Data-Dredging hin. Bei der Suche nach Mustern in Zeitreihen besteht die Gefahr, zufällige Zusammenhänge zu entdecken, die keine tatsächliche Aussagekraft besitzen. Deshalb ist es wichtig, Hypothesen mit verschiedenen Datensätzen zu überprüfen, was in der Praxis jedoch selten konsequent umgesetzt wird.
Herausforderungen bei der Datenanalyse
Ein weiteres Problem ergibt sich aus der Tatsache, dass es meist nur eine historische Zeitreihe gibt, deren Entstehung einem unbekannten Zufallsprozess unterliegt. Werden unterschiedliche Zeiträume, wie etwa die Aktienkurse eines Unternehmens in verschiedenen Jahrzehnten, getrennt betrachtet, entstehen zusätzliche Schwierigkeiten, da sich die Rahmenbedingungen verändern. Besonders im Hochfrequenzhandel zeigt sich, dass Handelsaktivitäten nicht gleichmäßig über die Zeit verteilt sind. Softwareentwickler integrieren häufig runde Zahlen in ihre Programme, was zu Häufungen von Transaktionen in bestimmten Intervallen führt. Auch Handelsmodelle arbeiten oft mit klar definierten Kursmarken, die von Programmierern vorgegeben werden.
Die Verbindung von technischer und fundamentaler Analyse
Besonders interessant sind Kombinationen aus technischer und fundamentaler Analyse. Wird beispielsweise anhand fundamentaler Daten eine Unterbewertung festgestellt und technische Indikatoren signalisieren einen Trendkanal, kann dies auf ein sogenanntes „Value Event“ hinweisen. In solchen Fällen erkennen auch andere Marktteilnehmer die Unterbewertung und reagieren entsprechend. Institutionelle Investoren führen bei ihren Transaktionen in der Regel mehr Analysen durch als Privatanleger. Ihr Handelsverhalten, oft als „Smart Money“ bezeichnet, beeinflusst die Märkte besonders stark, da sie große Volumina bewegen und ihre Aufträge häufig in der Schlussauktion platzieren.
Strategien institutioneller Anleger und Marktbeeinflussung
Große Marktteilnehmer versuchen, ihre Aufträge zu verschleiern, indem sie sie in viele kleinere Orders aufteilen, um negative Kurseffekte wie „Slippage“ zu vermeiden. Bei sogenannten Iceberg Orders ist nur ein kleiner Teil des Gesamtauftrags im Orderbuch sichtbar. Sobald eine Teilorder ausgeführt ist, wird automatisch die nächste Portion nachgelegt. Obwohl es technische Indikatoren gibt, die das Handelsvolumen berücksichtigen, gelingt es mit Standardwerkzeugen meist nicht, solche verdeckten Orders zuverlässig zu identifizieren.
Die Bedeutung der Chartdarstellung
Ein weiteres Phänomen der Chartanalyse betrifft die Darstellung der Kursverläufe. Fast alle Privatanleger nutzen lineare Charts, bei denen die Abstände auf der vertikalen Kursskala gleichbleibend sind. Logarithmische Charts hingegen verringern die Abstände mit steigendem Kursniveau und bieten eine realistischere Einschätzung der Wertentwicklung über längere Zeiträume. Da Webseiten meist lineare Charts anzeigen, entsteht für Privatanleger oft ein verzerrtes Bild der tatsächlichen Performance. Eine einmal erreichte Überrendite verzinst sich mit dem Basiswert, wodurch sich die Schere zwischen aktivem und passivem Management scheinbar immer weiter öffnet. Um Managementleistungen korrekt beurteilen zu können, sollte daher bevorzugt mit logarithmischen Charts gearbeitet werden.