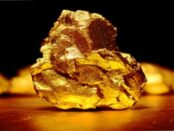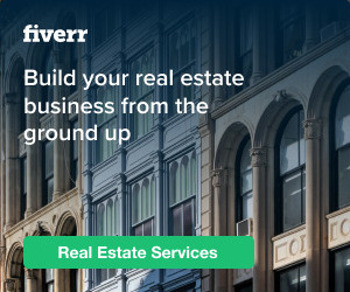Auf welche Weise könnten sich Auffälligkeiten bei Renditen im Bereich der Finanzmärkte manifestieren?
 Screenshot youtube.com
Screenshot youtube.comIm Mittelpunkt der Finanzmarkttheorie steht das sogenannte Kapitalmarktgleichgewichtsmodell, bekannt als »Capital Asset Pricing Model« (CAPM). Unter idealisierten Voraussetzungen – wie rational handelnden Investoren, homogenen Erwartungen und dem Fehlen von Transaktionskosten – ergibt sich im Gleichgewicht eine lineare Beziehung zwischen Risiko und Rendite. Demnach kann nur derjenige eine höhere Rendite erzielen, der bereit ist, zusätzliches Risiko zu tragen. In der Praxis zeigen sich jedoch zahlreiche Abweichungen von diesem Modell, da die Kapitalmärkte selten unter perfekten Bedingungen agieren.
Rolf Banz war der Erste, der nachwies, dass kleinere Unternehmen im Durchschnitt höhere Renditen als größere Firmen aufweisen – ein Phänomen, das als »Size-Effekt« bezeichnet wird. Tatsächlich lassen sich mit Aktien kleinerer Unternehmen oft überdurchschnittliche Gewinne erzielen, da der Wettbewerb um Informationsvorteile in diesem Segment geringer ist. Aufgrund des begrenzten investierbaren Volumens bei kleinen Unternehmen und den dadurch höheren Kosten für eine umfassende Analyse verzichten vor allem große Fondsgesellschaften häufig auf diese Anlageklasse.
Langfristig schneiden Substanzwerte mit niedrigen Bewertungen besser ab als Wachstumswerte; dieses Phänomen wird in der Fachliteratur als »Value Premium Puzzle« bezeichnet. Ein Grund hierfür ist der sogenannte »institutionelle Imperativ«, nach dem Fondsmanager dazu neigen, dem Mainstream zu folgen und überbewertete »Glamour Stocks« zu kaufen. Zudem sind viele Investoren zu optimistisch und extrapolieren vergangene Trends oder historische Wachstumsraten zu lange in die Zukunft hinein.
Im Jahr 2000 wurde das US-amerikanische Telekommunikationsunternehmen Cisco mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 120 bewertet und erreichte eine Marktkapitalisierung von 465 Milliarden US-Dollar. Analysten sahen das Unternehmen damals bereits auf dem Weg zum ersten 1-Billionen-USD-Konzern weltweit, obwohl die Bewertung bereits das Dreifache des Bruttosozialprodukts von Kalifornien betrug. Kurz darauf fiel der Aktienkurs um 85 Prozent, und selbst heute liegt die Aktie noch etwa 64 Prozent unter ihrem Allzeithoch von vor 16 Jahren.
Kurzfristig gilt diese langfristige Perspektive jedoch nicht uneingeschränkt, weshalb der sogenannte Momentum-Effekt beobachtet wird: Aktien, deren Kurse bereits gestiegen (oder gefallen) sind, tendieren dazu, kurzfristig weiter zu steigen (bzw. zu fallen). Diese Beobachtung widerspricht der Effizienzmarkthypothese. Eine mögliche Erklärung liefert die marktwertgewichtete Zusammensetzung vieler Indizes: Steigende (fallende) Aktien müssen weiterhin gekauft (verkauft) werden, da ihr Anteil im Index entsprechend zunimmt (abnimmt).
Werner De Bondt und Richard Thaler zeigten in einer viel beachteten Studie, dass der Kauf von Verliereraktien bei gleichzeitiger Leerverkaufspositionierung auf Gewinneraktien – das sogenannte Winner-Loser-Portfolio – aufgrund von Überreaktionen der Marktteilnehmer zu signifikanten Überrenditen führt. Diese Vorgehensweise wird in der Literatur auch als Contrarian-Strategie bezeichnet und zählt zu den bekanntesten Anomalien der 1980er Jahre. Sie entspricht dem Börsenspruch: »Sei gierig, wenn alle anderen ängstlich sind, und sei ängstlich, wenn alle anderen gierig sind.«
Viele Modelle der modernen Finanztheorie gehen von einem zufälligen Prozess für Renditen aus (»Random Walk«), sodass kein Zusammenhang zwischen aufeinanderfolgenden Tagen und deren Renditen bestehen sollte. Empirisch treten jedoch häufig Anomalien innerhalb bestimmter Zeiträume auf, die als Kalendereffekte bekannt sind. Die Kalenderzeithypothese besagt, dass an jedem Kalendertag Renditen erwirtschaftet werden – was dem Montag eine besondere Bedeutung verleiht: Da seit Handelsschluss am Freitag zwei freie Tage vergangen sind, sollten die Renditen am Montag das Dreifache eines normalen Wochentags betragen. Demgegenüber steht die Handelszeithypothese, nach der Renditen ausschließlich während der Börsenöffnungszeiten generiert werden und somit gleichmäßig auf alle Werktage verteilt sein müssten.
Michel Dubois und Pascal Louvet analysierten die Renditen in neun Ländern im Zeitraum von 1969 bis 1992. Mit Ausnahme Australiens zeigte sich am Montag durchschnittlich eine negative Rendite. Zudem war dieser Wochentag stets der schlechteste hinsichtlich der Performance. Josef Lakonishok und Edwin Maberly stellten fest, dass Privatanleger am Montag tendenziell mehr Verkaufs- als Kauftransaktionen tätigen, was häufig durch den Einfluss von Brokern erklärt wird. Diese geben überwiegend Kaufempfehlungen heraus, da sie an den Provisionen für Aktienverkäufe verdienen. Nach dem Wochenende haben viele Anleger Abstand von dieser Verkaufsdynamik gewonnen und neigen daher eher dazu, Positionen abzubauen.
Eine weitere plausible Erklärung lautet: Unternehmen veröffentlichen schlechte Nachrichten oft nicht während der Haupthandelszeiten, sondern bevorzugt am Freitagnachmittag, um dem Markt Zeit zur Verarbeitung zu geben. Kommt es zudem bei großen Firmen zu Problemen – wie etwa während der Finanzkrise –, finden meist Krisensitzungen über das Wochenende statt. Dies führt dazu, dass die Nervosität am Montag besonders hoch ist.
Ein langfristig besonders günstiger Monat für Aktieninvestitionen ist der Januar. Aus steuerlichen Gründen verkaufen institutionelle Anleger häufig kurz vor Jahresende verlustbringende Aktienbestände und kaufen diese kurz danach wieder zurück – ein Vorgang, der als »Window Dressing« bezeichnet wird. Dieser Effekt ist bei kleineren und weniger liquiden Aktien stärker ausgeprägt. Außerdem werden im Januar neue Risikobudgets für institutionelle Investoren festgelegt, was Anlegern mit Verlusten aus dem Vorjahr einen Wiedereinstieg ermöglicht.
Eine häufig genutzte Methode zur Identifikation kurzfristiger Handelsmöglichkeiten ist die technische Aktienanalyse, deren Grundlagen im folgenden Kapitel erläutert werden.