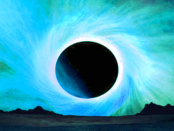Ist es für gewöhnliche Menschen noch möglich, ihre Privatsphäre zu bewahren?
 Screenshot youtube.com
Screenshot youtube.comZahlreiche Beispiele und Entwicklungen verdeutlichen, dass der Schutz der Privatsphäre in den vergangenen Jahren zunehmend eingeschränkt wurde und heute im Kern gefährdet ist. Erfolgversprechende Gegenmaßnahmen müssen dabei gleichzeitig auf technologischer Ebene sowie durch rechtliche, politische und wirtschaftliche Steuerungsmechanismen ansetzen.
Konzepte zum Schutz der Privatsphäre können nur dann verhindern, dass sich die Gesellschaft zu einer Überwachungsgesellschaft entwickelt – und möglicherweise sogar eine Umkehr bewirken –, wenn technologische und juristische Instrumente miteinander verbunden werden und dabei auch globale Zusammenhänge berücksichtigt werden. Letztlich geht es um nichts Geringeres als die Entwicklung einer weltweiten Ethik des Informationszeitalters, deren Schwerpunkt auf der Bewahrung und Förderung der individuellen Selbstbestimmung liegt: Verantwortung statt Kontrolle!
In den meisten Debatten zur Ethik des Informationszeitalters, wie sie beispielsweise im Rahmen des »Weltgipfels der Informationsgesellschaft« geführt werden, stehen vor allem Fragen des Zugangs zu Informationstechnologien und Informationen im Vordergrund. Dabei geht es einerseits um die soziale Ungleichheit bei der Teilhabe an den Vorteilen der Informationsgesellschaft, andererseits um die Kluft zwischen Staaten mit hochentwickelter Informationsinfrastruktur und Entwicklungsländern, in denen viele Menschen nicht einmal über einen Telefonanschluss verfügen.
Beide Aspekte werden unter dem Begriff »digitale Spaltung« (Digital Divide) zusammengefasst. Daraus ergibt sich – insbesondere von unabhängigen Beobachtern und Kritikern einer ungebremsten, vorwiegend aus wirtschaftlichen Interessen getriebenen Verbreitung von Informationstechnologien – die Forderung nach einem möglichst allgemeinen, freien und kostenfreien Zugang zu informationstechnischen Systemen.
Es stellt sich daher die Frage: Warum erhält der Schutz der Privatsphäre und des Datenschutzes nicht annähernd dieselbe Aufmerksamkeit? Diese Vernachlässigung überrascht besonders angesichts der Bedrohungen, die mit dem Übergang zu allgegenwärtiger Datenverarbeitung und der Umwandlung hoch technisierter Gesellschaften in Überwachungsgesellschaften einhergehen.
Diskutiert werden müssen nicht nur Überwachungstechniken im engeren Sinne – wie beispielsweise Videoüberwachung –, sondern auch Technologien, bei denen Daten quasi beiläufig im täglichen Umgang mit Gebrauchsgegenständen anfallen. Angesichts der schnellen technischen Entwicklungen steht weniger die Frage nach neuen rechtlichen Regelungen oder technischen Werkzeugen im Vordergrund, mit denen sich bestimmte Risiken vermeiden oder mindern lassen. Vielmehr geht es um grundlegende ethische Entscheidungen darüber, wie unsere Gesellschaft mit diesen Technologien und den dabei entstehenden persönlichen Datenspuren umgehen möchte. Nur wenn es gelingt, einen breiten gesellschaftlichen Konsens zu diesem Thema zu erzielen, besteht Hoffnung, die Privatsphäre im Informationszeitalter zu erhalten oder wiederherzustellen.
Bereits 1998 formulierte der damalige Direktor der UNESCO-Abteilung für Information und Informatik eine »ethische Vision der Informationsgesellschaft« und betonte dabei, dass
der Schutz des Privatlebens am Ende dieses Jahrhunderts zu einer der zentralen Aufgaben im Bereich der Menschenrechte geworden sei. Er stehe in engem Zusammenhang mit den Grundlagen der Menschenwürde und dem heiligen Wesen des Individuums, das durch kommerzielle und politische Interessen durch gefährliche Formen des Eindringens bedroht werde. Werden es Bürgerinnen und Bürger sowie Konsumenten schaffen, angesichts der räuberischen Begierde elektronischer Inquisitoren einen ethischen Rahmen zu schaffen,der die Integritätder persönlichen Identität im Zeitalter globaler Überwachung und allgegenwärtigen Belauschens garantiert?
Es existieren zwar Ansätze zur Entwicklung einer globalen Ethik des Datenschutzes, wie etwa die »Erklärung von Montreux« auf der 27. Internationalen Datenschutzkonferenz 2005; diese finden jedoch außerhalb des eng umrissenen Datenschutzkreises nur geringe Beachtung. Im Folgenden sollen verschiedene Ansätze zur Umsetzung und Durchsetzung ethischer Standards für die Informationsgesellschaft vorgestellt werden, wobei den technologischen Anforderungen eine besondere Bedeutung zukommt.