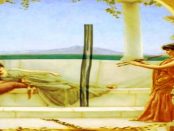Wie der Prozess der Deflation abläuft und welche ökonomischen Konsequenzen damit verbunden sind?
 Screenshot youtube.com
Screenshot youtube.comWenn Preisreduktionen auf einer gesteigerten Effizienz basieren, können sie sich auch förderlich auf die wirtschaftliche Entwicklung auswirken. Ein solches Bild zeigte sich im 19. Jahrhundert. In jener Zeit herrschte ein starkes Wirtschaftswachstum, die Löhne blieben stabil oder stiegen sogar an, während gleichzeitig eine positive Deflation vorherrschte. Im Gegensatz dazu sind die Preisnachlässe der Deflation im 20. und 21. Jahrhundert ausschließlich auf mangelnde Nachfrage, massive Verschuldung und spekulative Blasen zurückzuführen. Dies bewirkt, dass Unternehmen ihre Investitionen einstellen, da diese keine ausreichenden Renditen mehr versprechen, und Verbraucher ihre Ausgaben möglichst hinauszögern, weil die Waren immer günstiger werden.
Die negative Deflation führt folglich zu einer tiefgreifenden Wirtschaftskrise sowie hoher Arbeitslosigkeit. Produkte und Dienstleistungen werden kontinuierlich billiger. Dadurch sinken die Gewinnprognosen der Unternehmen, welche daraufhin weniger investieren und stattdessen versuchen, ihre Kosten zu minimieren. Die Arbeitslosigkeit nimmt zu, die Einkommen gehen zurück. Das Konsumverhalten wird gedrosselt, die Nachfrage nach Konsumgütern schrumpft, und infolgedessen verringern sich auch die Steuereinnahmen des Staates. Die gesamte Wirtschaftsleistung nimmt stetig ab. Das Resultat ist eine Krise sowohl in der Realwirtschaft als auch an den Finanzmärkten.
Eine negative Deflation stellt für hoch verschuldete Staaten, Unternehmen und private Haushalte einen besonders schweren Albtraum dar. Während Preise, Gewinne und Löhne in einer Deflationsphase sinken, bleibt der Rückzahlungswert von Krediten und anderen Schuldtiteln unverändert bestehen. Schuldner sind daher die großen Verlierer dieser negativen Deflation, da die durch Kredite finanzierten Vermögenswerte in Geldeinheiten gemessen an Wert verlieren, sie jedoch weiterhin den ursprünglich festgelegten monetären Betrag begleichen müssen.
Aus diesem Grund werden betroffene Regierungen – wie etwa jene der EU, Japans oder der USA – alles daran setzen, eine Deflation zu verhindern, obwohl mehrere Versuche, die Wirtschaft mittels Gelddruckerei anzukurbeln, bislang erfolglos blieben. Hingegen profitieren Besitzer liquider Geldvermögen („Cash is King“) von einer Deflation, da ihr Kapital an Kaufkraft gewinnt. In der Folge kommt es vermehrt zu Insolvenzen überschuldeter Unternehmen mit negativen Folgen für deren Beschäftigte sowie Gläubiger.
Eine mögliche Konsequenz ist eine sogenannte Schuldendeflation – eine Finanzkrise verbunden mit einer sich durch Sparmaßnahmen von Wirtschaftsakteuren und Bevölkerung verstärkenden Deflation, was die Wirtschaftskrise weiter vertieft. Ben Bernanke, ehemaliger Vorsitzender der US-Notenbank (FED/PRB), sowie viele seiner Kollegen gehen davon aus, dass eine Deflation durch geld- und fiskalpolitische Maßnahmen – notfalls auch mittels quantitativer Lockerung (also expansiver Geldpolitik durch Ankauf von Staatsanleihen oder Wertpapieren durch Zentralbanken mit dem Ziel der Konjunkturbelebung) – „rasch“ beendet werden kann.
Diese Annahme erweist sich jedoch als weitgehend falsch. Bislang gab es drei umfangreiche Gelddruckaktionen ohne nennenswerte positive Effekte für rund achtzig Prozent der Bevölkerung. So sanken die realen Einkommen in den USA trotz dieser inflationären Maßnahmen in den letzten zehn Jahren um fast zehn Prozent; in Deutschland lag der reale Einkommensverlust im gleichen Zeitraum bei etwas über einem Prozent. Während Wohlhabende durch erhebliche Kursgewinne profitieren, erhalten durchschnittliche Bürger nur einen sehr kleinen Anteil dieser Geldflut.
Im Zuge der Finanzkrise ab 2007 wurde von Seiten der FED/PRB und politischen Entscheidungsträgern eine „Deflationsgefahr“ erkannt – eine Einschätzung, die zweifellos zutreffend war –, doch waren die ergriffenen Maßnahmen grundlegend falsch: Marode Banken wurden gerettet, Großvermögen vor hohen Verlusten bewahrt und ein nicht rückzahlbarer Schuldenberg aufgebaut; der einfache Bürger blieb dabei völlig außen vor und muss letztlich dafür bezahlen. In Japan ist seit den 1990er-Jahren trotz massiver quantitativer Lockerungen sowie umfangreicher Infrastrukturförderprogramme ein kontinuierlich sinkendes Preisniveau zu beobachten.
Seit über fünf Jahren laufen die Gelddruckmaschinen in den USA, Japan und Europa auf Hochtouren – dennoch fallen die realen Einkommen unaufhörlich. Die Nachfrage bleibt schwach; Produktivität und Effizienz lassen stark zu wünschen übrig. Selbst das Gewinnwachstum vieler Unternehmen verlangsamt sich zunehmend. Die große Gruppe der alternden Babyboomer mit ihrem zurückhaltenden Konsumverhalten wirkt den fiskalischen Maßnahmen der Regierungen entgegen. Die demografische Alterung wurde von den Verantwortlichen der FED/PRB in ihren theoretischen Modellen kaum bis gar nicht berücksichtigt. Am Ende bleiben nur dramatisch gestiegene Staats- und Zentralbankverschuldungen zurück – Kosten, für die letztlich der Steuerzahler aufkommen muss – sowie ein Finanzsystem mit deutlich höheren Ausfallrisiken als vor der Krise.
Insbesondere durch das Platzen spekulativer Blasen wie etwa Immobilienblasen sowie Börsencrashs zwischen 2006 und 2009 kommt es zu einer Vermögensdeflation – vor allem dann, wenn Vermögenswerte kreditfinanziert wurden. Sinkende Vermögenspreise führen zur Überschuldung von Haushalten, was wiederum Kreditausfälle nach sich zieht und Banken in Schwierigkeiten bringt.
Da nun weniger neue Kredite vergeben werden als auslaufen oder ausfallen, schrumpft die Geldmenge. Aus diesem Grund sparen amerikanische Privathaushalte seit einigen Jahren außergewöhnlich stark; ihre Verbindlichkeiten wurden seit 2007 um fast zehn Prozent beziehungsweise nahezu fünf Billionen US-Dollar reduziert. Dies geschieht allerdings zulasten des Konsums und fördert somit die Deflation weiter. Dies geschieht trotz beeindruckender Wachstumszahlen der US-Wirtschaft – Zahlen, welche teilweise manipuliert sind und nicht der Realität entsprechen. Die Bürger spüren dies intuitiv anhand ihrer tatsächlichen Kaufkraftentwicklung: Ihr verfügbares reales Einkommen sinkt seit rund einem Jahrzehnt deutlich; das reale Einkommen der US-Mittelschicht liegt mittlerweile auf dem Niveau der späten 1970er-Jahre. Daher schrumpft diese Mittelschicht rapide.
Die ultrareichen Amerikaner (etwa 0,1 % der Bevölkerung) werden den Konsum kaum noch ankurbeln können, da sie bereits über nahezu sämtliche Güter verfügen. Zudem steigen bestimmte Kosten in den USA – wie Mieten, Gesundheitsversorgung sowie höhere Bildungsausgaben –, welche kaum oder gar nicht in den offiziellen Inflationszahlen berücksichtigt werden. Auch kommunale Gebühren etwa für Strom-, Wasser- und Müllentsorgung sowie Gewerbesteuern steigen sowohl in den USA als auch in Deutschland seit Jahrzehnten kontinuierlich an.
Ohne die Kursmanipulationen und Gelddruckaktionen von Federal Reserve Bank (FED/PRB), Europäischer Zentralbank sowie Bank von Japan wäre die westliche Weltwirtschaft längst in einer langanhaltenden depressiven negativen Deflation versunken. Um einen Zusammenbruch zu vermeiden, werden diese Interventionen seitens der Zentralbanken aller Voraussicht nach mindestens bis zur US-Präsidentschaftswahl im November 2016 fortgeführt werden. Kleine Zinserhöhungen dienen dabei lediglich kosmetischen Zwecken und sollen dem Markt signalisieren, dass die Strategie zur Geldvermehrung funktioniert und das Wirtschaftswachstum stark zunimmt – eine Illusion basierend auf zum Teil unzuverlässigen oder manipulierten volkswirtschaftlichen Daten.
Der Nachteil dieser Marktmanipulationen besteht darin, dass das globale Wirtschaftssystem mittelfristig zusammenbrechen wird: Der Verschuldungsgrad einiger Länder ist inzwischen so hoch, dass selbst geringfügige Zinssteigerungen zu dramatischen Wertverlusten führen können – bis hin zur Staatsinsolvenz. Zudem wird in den kommenden Jahren mit einer massiven Vertrauenskrise gegenüber großen Fiat-Währungen wie Yen, Euro und US-Dollar gerechnet; wobei der US-Dollar als letzte große Währung zusammenbrechen dürfte.
Demografische Faktoren sind dabei aus Sicht des Autors gewichtiger als politisch motivierte Gelddruckprogramme – dies zeigt exemplarisch das japanische Beispiel: Trotz intensiver Bemühungen der Notenbanken zur Inflationsförderung sind inflationsbedingte Risiken innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre eher unwahrscheinlich. Mittel- bis langfristig steigt jedoch die Wahrscheinlichkeit einer Hyperinflation ebenso wie eines wirtschaftlichen Zusammenbruchs mit anschließender Staatsentschuldung durch tiefgreifende Währungsreformen.
Vorerst gilt jedoch: Cash ist King. Nur äußerst selektiv erscheinen attraktiv bewertete nichtzyklische oder antizyklische Aktien als sinnvoller Besitz; selbst langfristige Anleihen von solventesten Emittenten sind für eine gewisse Zeit noch erwägenswert. Doch bevor das tendenziell deflationäre Umfeld mit künstlich erzeugtem Wirtschaftswachstum in ein inflationäres Klima mit gravierenden ökonomischen Folgen umschlägt, sollten Anleihen und Aktien verkauft werden; das Kapital sollte dann in werthaltige Anlagen investiert sein, welche sich in einem zunehmend inflationären Umfeld bewähren.