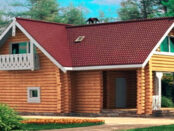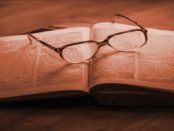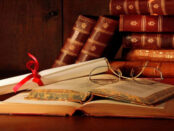Grüne Paradiese. Historische Gärten in der Lausitz: “Buch stellt die neun Parkanlagen des Europäischen Parkverbunds Lausitz vor”
 Screenshot youtube.com
Screenshot youtube.com
Lausitzer Literatur – Das Buch >>Grüne Paradiese. Historische Gärten in der Lausitz<< stellt ausgewählte Parkanlagen und historische Personen des öffentlichen Lebens der Lausitz vor. Es wird mit zahlreichen stimmungsvolle Bilder ergänzt.
“Mit dem Buch „Grüne Paradiese. Historische Gärten in der Lausitz“ gibt es jetzt erstmals einen reich gestalteten Bild-Text-Band über die Garten- und Parkanlagen, die im Europäischen Parkverbund Lausitz vereint sind. Der Band ist in der Edition Braus des Aufbau-Verlages in Berlin erschienen.”
“Das Buch stellt die neun Parkanlagen des Europäischen Parkverbunds Lausitz vor, die sich in der Euroregion Spree-Neisse-Bober befinden. Geschaffen von herausragenden historischen Persönlichkeiten wie Fürst Pückler, Heinrich Graf von Brühl oder Dorothea Herzogin von Sagan, bildeten diese Residenzen und Parkanlagen kulturelle Kristallisationspunkte mit europaweiten Verbindungen, die ihre Strahlkraft bis heute bewahrt haben.”
“Stimmungsvolle Bilder des Fotografen Leo Seidel entführen in großartige Gartenwelten und zeigen neben den vielfältigen Querverbindungen die Besonderheiten der einzelnen Parks auf. Sachkundige Texte bieten Informationen zur Entstehungsgeschichte der Anlagen. In atmosphärischen Bildern lädt das Buch zu einer Entdeckungsreise dieser Gartenlandschaft ein.”