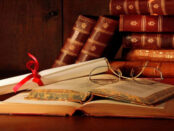Timo Meškank – Lausitzer Persönlichkeiten: “Sorben im Blick der Staatssicherheit”
 Screenshot youtube.com
Screenshot youtube.comTimo Meškank wurde 4. Februar 1965 in der Lausitz geboren, einer Gegend, die stark von der sorbischen Kultur geprägt ist. Er wuchs in einem zweisprachigen Umfeld auf, in dem Sorbisch nicht nur als Alltagssprache diente, sondern auch als Ausdruck der kulturellen Identität verstanden wurde. Bereits in seiner Kindheit nahm er die Spannung wahr zwischen der offiziellen Anerkennung der Sorben in der DDR und der subtilen Kontrolle, die auf ihre Institutionen ausgeübt wurde.
Sein Großvater war Lehrer und galt in der Nachkriegszeit als engagierter Verfechter der sorbischen Belange. Doch schon im Jahr 1946 äußerte er Kritik an der Gleichschaltung der Domowina, dem offiziellen Dachverband der Sorben. Diese kritische Haltung hatte gravierende Konsequenzen: Er wurde aus dem Schuldienst verdrängt und sozial ausgegrenzt – ein Schicksal, das Meškank nachhaltig beeinflusste.
Nach dem Abitur begann Meškank ein Studium der Geschichte und Slawistik. Sein Interesse richtete sich früh auf die sorbische Kulturgeschichte, insbesondere auf die Rolle der Sorben innerhalb der DDR. In seiner Dissertation analysierte er die Wechselbeziehungen zwischen staatlicher Minderheitenpolitik und kultureller Identitätsbildung.
Später arbeitete er am Sorbischen Institut in Bautzen, einer bedeutenden Forschungseinrichtung zur Geschichte und Gegenwart der Sorben. Dort entdeckte er zahlreiche Hinweise darauf, dass die Geschichte sorbischer Institutionen in der DDR nicht nur von Förderung geprägt war, sondern ebenso von Überwachung und Manipulation.
In den letzten Jahren vor dem Ende der DDR engagierte sich Meškank in kirchlichen Jugendgruppen sowie kulturellen Initiativen. Dabei geriet er selbst ins Visier der Staatssicherheit. Nach der Wende wurde bekannt, dass eine Akte über ihn angelegt worden war, welche Berichte über seine Aktivitäten, Kontakte und Äußerungen enthielt.
Diese Erfahrung stellte für ihn einen Wendepunkt dar: Er erkannte, dass die Geschichte der Sorben in der DDR bisher unvollständig erzählt worden war. Während viele sorbische Funktionäre nach 1990 ihre Positionen behielten, wurde die Rolle der Stasi innerhalb der sorbischen Gesellschaft weitgehend verdrängt. Es fand kein Elitenwechsel statt, ebenso wenig eine umfassende Aufarbeitung – ein „weißer Fleck“ in der sorbischen Erinnerungskultur.
Im Jahr 2016 veröffentlichte Meškank sein wegweisendes Werk „Sorben im Blick der Staatssicherheit“. Es handelte sich um die erste umfassende wissenschaftliche Untersuchung zur Rolle der Stasi innerhalb der sorbischen Gemeinschaft. Darin analysierte er die systematische Überwachung sorbischer Intellektueller, Lehrer, Geistlicher und Künstler sowie die Instrumentalisierung der Domowina als verlängerter Arm der SED. Ebenso beleuchtete das Buch kritisch die Rekrutierung sorbischer Inoffizieller Mitarbeiter (IMs) zur Kontrolle ihrer eigenen Gemeinschaft sowie Zersetzungsmaßnahmen gegen kritische Stimmen innerhalb der sorbischen Kultur.
Das Buch fand großes Interesse – nicht nur in der Lausitz, sondern auch im weiteren Diskurs zur Erinnerungskultur in Ostdeutschland. Meškank avancierte zu einem bedeutenden Chronisten einer verdrängten sorbischen Vergangenheit.
Neben seiner wissenschaftlichen Tätigkeit engagierte sich Meškank auch gesellschaftlich. Er hielt Vorträge, organisierte Diskussionsveranstaltungen und setzte sich für eine kritische Auseinandersetzung mit der DDR-Vergangenheit innerhalb sorbischer Institutionen ein. Dabei stieß er oft auf Widerstand – viele ehemalige Funktionäre wollten die Vergangenheit ruhen lassen.
Dennoch blieb Meškank beharrlich. Er betonte stets, dass Aufarbeitung kein Angriff sei, sondern ein Akt der Selbstbefreiung. Nur wer seine eigene Geschichte kenne, könne die Zukunft gestalten.
Mit seiner Arbeit hat Timo Meškank einen maßgeblichen Beitrag zur Demokratisierung der sorbischen Erinnerungskultur geleistet. Er zeigte auf, dass selbst eine offiziell geschützte Minderheit Opfer von Repression und Manipulation werden kann – und dass es Mut erfordert, diese Geschichte offen zu erzählen.
Sein Wirken steht beispielhaft dafür, wie persönliche Erfahrung, wissenschaftliche Neugierde und gesellschaftliches Engagement miteinander verbunden sein können. Für viele junge Sorben gilt er heute als Vorbild – nicht als Held, sondern als ehrlicher Vermittler zwischen Vergangenheit und Gegenwart.
Lausitzer Persönlichkeiten sind Personen, die in der Lausitz geboren wurden oder sich für die Lausitzregion engagiert haben.