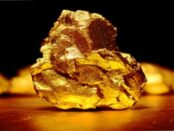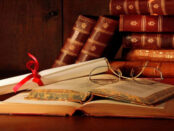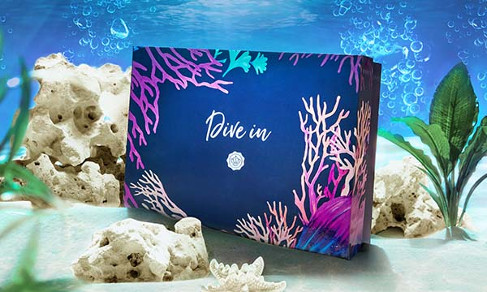Wie gestaltet sich die mathematische Struktur der Märkte im Bereich der Finanzen?
 Screenshot youtube.com
Screenshot youtube.comDer Nobelpreisträger William Sharpe belegte, dass das durchschnittliche Ergebnis aktiver Portfoliomanager im Wesentlichen dem Erfolg des Index – dem Bezugsmaßstab oder der sogenannten »Benchmark« – abzüglich der durchschnittlichen Kosten entspricht.
Denn wenn ein Fondsmanager eine Aktie gegenüber dem Index übergewichtet, gibt es zwangsläufig einen anderen Fondsmanager, der diese Aktie entsprechend untergewichtet. Die summierten Abweichungen vom Index gleichen sich somit zu einem Nullsummenspiel aus.
Folglich gilt: Wenn einige aktive Fondsmanager einen Mehrwert erzielen, müssen andere aktive Manager im gleichen Umfang Verluste hinnehmen. Der durchschnittliche aktive Fondsmanager kann daher nur die Rendite des Index erreichen. Da jedoch bei jedem Fonds Kosten anfallen, liegt die Rendite aktiver Fonds stets unterhalb der Indexrendite um diese Kosten. Passive Anleger erzielen ebenfalls die Benchmarkrendite minus ihrer Gebühren, welche jedoch deutlich geringer ausfallen als jene aktiver Manager.
Aus diesem Grund sind im Gesamtergebnis Indexfonds den klassischen Investmentfonds überlegen. Kenneth French weist darauf hin, dass Anleger in den USA zwischen 1980 und 2006 im Mittel jährlich 0,67 % Gebühren für die Suche nach Überrenditen bezahlten. Wird der Barwert dieser Zahlungsströme berechnet, belaufen sich die volkswirtschaftlichen Kosten des aktiven Portfoliomanagements auf etwa 10 % der gesamten Marktkapitalisierung.
Somit werden rund ein Zehntel der Wirtschaftsleistung für Informationsbeschaffung und Auswahl von Investitionsprojekten aufgewendet. Empirische Untersuchungen zeigen tatsächlich, dass die Mehrheit der Fondsmanager ihre Benchmark nicht schlägt. Je länger der Anlagezeitraum ist, desto wahrscheinlicher ist eine Underperformance des Fonds. Warum gelingt es dennoch aktiven Fondsmanagern regelmäßig, neue Mittel einzuwerben?
Dies liegt zum einen daran, dass einzelne Fonds tatsächlich sehr gute Ergebnisse erzielen. Zum anderen wird die gesamte Fondsbranche durch eine systematische Verzerrung geprägt, welche aktive Manager besser erscheinen lässt. Denn zu jedem Bewertungszeitpunkt werden nur jene Fonds berücksichtigt, die »überlebt« haben; die Renditen schlechter und bereits geschlossener Fonds bleiben unberücksichtigt.
Aus diesem Grund bewahren seriöse Marktdatenanbieter auch historische Daten auf, selbst wenn keine weiteren Kursinformationen mehr geliefert werden. Christopher Philips und Kollegen zeigen auf, dass mit zunehmendem Anlagehorizont die Wahrscheinlichkeit einer Underperformance steigt und langfristig nahezu sicher ist. Für Privatanleger, die keine gezielte Auswahl besonders fähiger Fondsmanager treffen können, stellt daher ein Indexfonds mit niedrigen Verwaltungsgebühren die bessere Alternative dar.
Würde es jedoch ausschließlich passive Anlagen geben und niemand würde die Fundamentaldaten von Unternehmen analysieren, wäre der Kapitalmarkt nicht effizient. Trotz aller Kritik am aktiven Portfoliomanagement lässt sich dessen Bedeutung nicht vollständig außer Acht lassen. Mit zunehmender Verbreitung von Indexfonds wird das Pendel ab einem gewissen Punkt wieder in Richtung aktives Management ausschlagen.
Aktive Portfoliomanager erzielen meist dann einen Mehrwert, wenn sie in Märkten tätig sind, in denen noch kein intensiver Wettbewerb herrscht.
Dies betrifft vor allem Nischen- oder kleinere Märkte. So ist etwa der kanadische Aktienmarkt deutlich weniger umkämpft als der US-amerikanische Markt – obwohl beide Märkte in derselben Zeitzone liegen und Nachrichten in derselben Sprache verfasst werden.
Auch dann können aktive Manager sinnvoll sein, wenn Anlagestrategien flexible Anpassungen erfordern. Aus diesem Grund gründen institutionelle Anleger häufig Spezialfonds, die nach ihren individuellen Vorgaben verwaltet werden.