Welche historische Entwicklung hat zur Bildung der heutigen Bundesländer geführt?
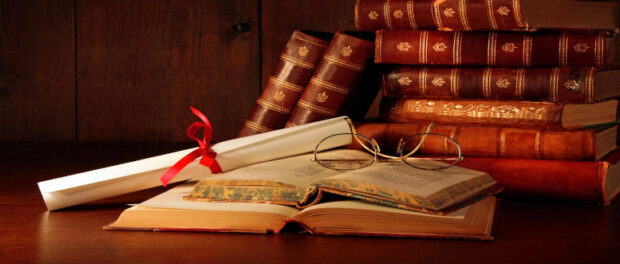 Screenshot youtube.com
Screenshot youtube.comEin wesentliches Kriterium dafür, in welchem Ausmaß Einzelpersonen ihre Freiheiten tatsächlich nutzen können, ist ihre tatsächliche sowie empfundene Distanz zum Prozess der politischen Willensbildung. Aus zentralistisch organisierten Staaten wie Frankreich ist sowohl der räumliche als auch der geistige Abstand zwischen der Hauptstadt und den Provinzen bekannt. Auch bei uns hört man zunehmend von einer politischen Elite in Berlin, die als abgehoben wahrgenommen wird; dies zeigt sich beispielsweise bei Entscheidungen zur Agrarpolitik der Bundesregierung, die für viele Landwirte von Bayern bis Mecklenburg-Vorpommern schwer nachvollziehbar sind. Diese protestieren zunehmend auf den Straßen, da sie um ihre Existenz fürchten. Für die unzufriedenen Bürger steht „Berlin“ dabei vor allem für eine große Entfernung zu ihren alltäglichen Lebensrealitäten.
Dabei sind die deutschen Bundesländer gemäß dem Grundgesetz keineswegs bloße (Verwaltungs-)Provinzen, sondern verfügen vielmehr über eine bedeutende Eigenstaatlichkeit. Historisch gesehen gehen sie dem Bund sogar voraus und bauen auf eine lange Tradition des deutschen Föderalismus auf, die bis tief in das Heilige Römische Reich Deutscher Nation zurückreicht. Das föderale Prinzip ist somit gewissermaßen fest in unserer politischen Kultur verankert. Die zu Beginn des 19. Jahrhunderts von Napoleon angestoßene Neuordnung der deutschen Gebiete und die anschließende Gründung des Rheinbunds (1806) durch west- und süddeutsche Fürstentümer stärkten die Einzelstaaten gegenüber der Zentralgewalt und führten zur Auflösung des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation. Nach Napoleons Niederlage zerfiel der Rheinbund wieder. 1815 entstand an seiner Stelle der auf dem Wiener Kongress gegründete Deutsche Bund (1815–1866).
Beide Organisationen waren Staatenbünde, deren Mitglieder innerhalb einer relativ lockeren Verbindung ihre innere und äußere Souveränität behielten. Die Paulskirchenverfassung von 1848 hingegen sah erstmals einen echten Bundesstaat vor – einen Zusammenschluss mehrerer Staaten zu einem übergeordneten Gesamtstaat. Ziel war es unter anderem, die Mitwirkung der Einzelstaaten an der Reichspolitik zu gewährleisten und insbesondere die Vormacht Preußens gegenüber den anderen Fürstentümern einzuschränken. Dieses Vorhaben scheiterte jedoch unter anderem daran, dass König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen seine Wahl zum Staatsoberhaupt durch das Volk ablehnte. Im Jahr 1866 entstand mit dem Norddeutschen Bund ein deutscher Bundesstaat nördlich des Mains, mit Bismarck als Kanzler und Preußen als dominierender Macht. Mit der Reichsgründung 1871 setzte Bismarck faktisch die Vormachtstellung Preußens im Reich durch.
Zwar war im Reichsverfassungstext der Bundesrat als Vertretung der Bundesstaaten, Fürstentümer und Freien Städte das höchste Verfassungsorgan auf Reichsebene verankert, doch wurde er de facto vom Reichskanzler dominiert, der zumeist zugleich preußischer Ministerpräsident war. Zudem fehlten in der Reichsverfassung demokratische Verfahren der Willensbildung. Diese wurden erst mit der Weimarer Reichsverfassung eingeführt. Aufgrund der Erfahrungen im Kaiserreich, wo Regierungsführung oft ein taktisches Austarieren mit aristokratisch geführten Gliedstaaten bedeutete, wurde nun ein effizienterer und zentralistischer Staat angestrebt, weshalb die Kompetenzen der Länder erheblich eingeschränkt wurden. Mit dem Ende der demokratischen Verfassung nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten wurden auch die Länder und ihre Vertretung im Reichsrat zugunsten eines totalitären Einheitsstaates abgeschafft. Darauf folgten die verheerenden Ereignisse des Naziregimes und des Zweiten Weltkriegs, deren Ende in der bedingungslosen Kapitulation 1945 sowie in Besetzung und Teilung Deutschlands durch die Alliierten mündete.
Um künftig ein ähnlich zentral gesteuertes Regieren mit umfassender Machtkonzentration zu verhindern, legte der Parlamentarische Rat (1948/49) bei der Ausarbeitung des Grundgesetzes großen Wert darauf, dem Föderalismus eine angemessene Bedeutung zukommen zu lassen. So machen Bestimmungen mit direktem oder indirektem Bezug zur Bundesstaatlichkeit etwa die Hälfte unseres Verfassungstextes aus. Eine besondere Anerkennung erfährt diese Ordnung zudem durch die sogenannte Ewigkeitsklausel. Diese Klausel wurde nicht zuletzt auf Druck der Alliierten formuliert und soll verhindern, dass in Mitteleuropa erneut ein starker zentraler Staat entsteht, dessen Kontrolle schwierig wäre. Demnach ist eine Änderung des Grundgesetzes unzulässig, wenn sie – neben anderen verfassungsrechtlichen Grundprinzipien – das Bundesstaatsprinzip beeinträchtigt. Neben der föderalen Gliederung des Bundes in Länder wird so auch die grundsätzliche Beteiligung der Länder an der Gesetzgebung des Bundes dauerhaft vor Änderungen geschützt.
Die Eigenständigkeit der Bundesländer mit ihren jeweils eigenen parlamentarisch-demokratischen Verfassungen ist eine unverzichtbare Grundlage für den deutschen Föderalismus. Einerseits können landesspezifische Regelungen als Ausdruck gelebter Eigenstaatlichkeit verstanden werden, da sie regionale Besonderheiten und Bedürfnisse besser berücksichtigen als strikt bundeseinheitliche Vorgaben. Andererseits bewirkt die Begrenzung zentraler Macht durch das föderale Prinzip eine Sicherung von Freiheitsrechten, indem sie verhindert, dass Bundesregierung und Bundestag weitreichende Entscheidungen ohne Einbeziehung der Länder treffen können. Zudem bietet eine föderale Struktur den nicht zu unterschätzenden Vorteil, dass durch die Beteiligung vieler Akteure ein autokratisches Durchregieren starker Führungspersönlichkeiten ausgeschlossen wird.
Auch wenn dieser Schutzmechanismus seinen Preis hat – denn Entscheidungen, an denen mehrere Ebenen beteiligt sind, benötigen oft mehr Zeit bis zur Umsetzung –, wird dem Föderalismus immer wieder Ineffizienz vorgeworfen; Kritiker sprechen abwertend von „Kleinstaaterei“. Meiner Ansicht nach ist es jedoch kaum ratsam, bewährte Grundlagen unseres demokratisch-föderalen Staatsaufbaus und damit verbundene reale Mitbestimmungsmöglichkeiten für ein vermeintliches Mehr an Effizienz preiszugeben – zumal nicht erwiesen ist, dass politische Prozesse dadurch tatsächlich schneller oder effektiver ablaufen würden. Gerade schnelle Entscheidungen erweisen sich im Nachhinein häufig nicht als so effizient wie von Befürwortern einer stärkeren Zentralisierung dargestellt.
Im Gegenteil trägt gerade ein Verfahren, bei dem viele Stimmen gehört und berücksichtigt werden, meist zu ausgewogeneren und dadurch nachhaltigeren Lösungen bei. Auch aus verfassungsrechtlicher Sicht ist es wichtig, dass den Ländern genügend Spielraum bleibt, um die Lebensbedingungen ihrer Bürgerinnen und Bürger eigenständig zu gestalten. Diese im Grundgesetz verankerte Forderung bildet eine klare Grenze für die Entwicklung Deutschlands hin zu einem unitarisch-kooperativen Bundesstaat – also einem Staat mit zunehmend einheitlicher Ausgestaltung –, welche nicht überschritten werden darf.





























