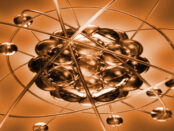Stellt sich die Frage, ob die Privatisierung von Flughäfen tatsächlich vorteilhaft ist
 Screenshot youtube.com
Screenshot youtube.comDer Bau, die Betriebsführung und die Finanzierung von Flughäfen wurden über lange Zeit hinweg ausschließlich dem Staat zugeordnet, und die Flughäfen in Deutschland befinden sich nach wie vor mehrheitlich oder vollständig im Besitz der öffentlichen Hand. Einer strikten und umfassenden Privatisierung im deutschen Flughafensektor steht bis heute die „sektorspezifische Regulierung des Staates“ entgegen, da sich die Eigentumsverhältnisse auf besondere Weise aus der Argumentation zur Daseinsvorsorge ableiten.
Allgemein wird angenommen, dass eine zu weitgehende Deregulierung des deutschen Flughafensektors aufgrund des häufig bestehenden natürlichen Monopols wenig sinnvoll sei. Politiker, die privatisierungsfreundlich eingestellt sind, untermauern diese Auffassung, indem sie privaten Investoren die Fähigkeit absprechen, wünschenswerte Vorhalte- und Erweiterungsinvestitionen zu tätigen. Trotz dieser Bedenken erfasste der Trend zur Privatisierung in den letzten Jahrzehnten schließlich auch den deutschen Flughafensektor.
Das kontinuierlich steigende Passagieraufkommen sowie die zunehmende Liberalisierung des globalen Luftverkehrs führten zu einem nahezu einzigartigen Wettbewerb. In diesem Zusammenhang würden – so die Befürworter der Privatisierung – auch an deutsche Flughäfen „höhere Anforderungen hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit und Effizienz gestellt“. Um die vermeintlich notwendige Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Luftfahrtsektors zu bewahren oder auszubauen, wird die monopolartige Bereitstellung von Flughafenleistungen durch den Staat zunehmend in Frage gestellt. Verfechter einer weiteren Privatisierung des „Flughafenmarktes“ sind daher der Meinung, dass die öffentliche Hand mehr denn je auf die Unterstützung privater Investoren angewiesen sei, um das Angebot an Flughafeninfrastruktur zu erweitern.
Im „Luftfahrtkonzept 2000“, das im Jahr 1994 veröffentlicht wurde, bekräftigte die damalige schwarz-gelbe Bundesregierung ihre Absicht, eine konsequente Privatisierung der Bundesanteile im deutschen Flughafenbereich voranzutreiben. Viele Befürworter der Privatisierung argumentieren, dass Flughäfen „ausnahmslos privatrechtlich in Form von Gesellschaften mit beschränkter Haftung oder Aktiengesellschaften“ organisiert werden sollten, insbesondere da viele Flughäfen in Deutschland mit schnellen und äußerst kostspieligen Expansionsinvestitionen konfrontiert seien. Ähnlich wie im Bahnwesen halten sie die Privatisierung von Flughäfen aus ordnungspolitischer Perspektive für notwendig, um in Zeiten leerer Staatskassen durch die Einbeziehung privater Kapitalgeber die Belastung öffentlicher Haushalte gering zu halten. Darüber hinaus könnte auf diese Weise ein Transfer von Management-Know-how initiiert werden, der in der Lage ist, die Produktivität der Flughäfen zu steigern. Materielle Teilprivatisierungen richteten sich in Deutschland bislang insbesondere auf umsatzstarke Flughäfen wie Frankfurt am Main (Fraport AG), Düsseldorf, Hamburg, Hannover und Mönchengladbach.
Der Flughafen Düsseldorf International wurde 1997 als erster deutscher Verkehrsflughafen teilprivatisiert, als die Landesregierung Nordrhein-Westfalens 50 Prozent ihrer Anteile an die Airport Partners GmbH veräußerte. In den Jahren 1998 und 2000 führte der Verkauf staatlicher Anteile zur Teilprivatisierung der Flughäfen Hannover und Hamburg. Im Gegensatz zu den zuvor genannten Flughäfen geschah die Teilprivatisierung des Frankfurter Flughafens im Rahmen eines Börsengangs im Juni 2001. Die rechtliche Grundlage für diesen Börsengang bildete die Gründung der mittlerweile weltweit aktiven Fraport AG. Unabhängig von der spezifischen Ausgestaltung der einzelnen Privatisierungen lässt sich feststellen, dass der Trend hin zu privatwirtschaftlich geführten Flughäfen voraussichtlich noch viele Jahre anhalten wird.