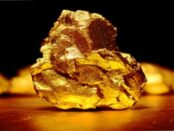Lausitzer Geschichte: Winterleben im Spreewald
 Screenshot youtube.com
Screenshot youtube.com
Einige Wegstunden hinter der Tuchmacherstadt Kottbus tritt die Spree in eine etwa 9 Meilen lange und 1 bis 1½ Meilen breite, vollständig flache Niederung ein, die sich auf ihrer ganzen Ausdehnung nur um einige Meter senkt.
___________________
Von Th. G.
___________________
Die Spree, bis dahin ein fröhlich fließendes Gewässer, befindet sich plötzlich in der größten Verlegenheit: es fehlt ihr an einer bestimmten Flußrinne, und so bleibt ihr denn nichts anderes übrig, als sich ziel- und planlos in Hunderte von Armen, „Blotas“, wie der Spreewaldwende sagt, zu zersplittern. Man spricht von 300 Spreearmen, und wenn man so gefällig sein will, beim Zählen einige Feld- und Wiesengräben mit in Betracht zu ziehen, so ist an dieser Zahl auch nichts zu mäkeln. Erst am Ende der Niederung findet sich der Fluß wieder zusammen, windet sich der Reichshauptstadt zu, um hier seine größte Lebensaufgabe zu erfüllen – ohne ihn würde ja kein Berliner mit Spreewasser getauft werden können.
Zwischen jenen Hunderten von Spreearmen nun breitet sich ein humusreiches fruchtbares Schwemmland aus und bildet Tausende von flachen Inseln, die sogenannten „Kaupen“. Wenn diese „Kaupen“ nicht mit malerischen Bauernhäusern besät sind, so leuchten sie im tiefsten Wiesengrün oder sie sind mit Wald überzogen; in die „Blotas“ herein ragen vom Ufer aus oft riesenhafte Sumpfgewächse, oder die Kanäle sind durch die dichten Laubkronen der Erlen und Eichen, Eschen und Ulmen förmlich eingedeckt. Die Uferhäuschen die stillen Mühlen, die Kanäle sind in eine laubgrüne Nacht eingebettet, und lautlos gleiten die Bauernkähne aneinander vorüber, als wollten sie dieses Stillleben nicht unterbrechen.
Im Winter aber, da geht’s im Spreewald lauter und lustiger her. Die Dörfer, die einzelnen Gehöfte, die im Sommer durch die Spreearme voneinander getrennt sind und den Verkehr unter sich nur durch Kähne vermitteln können, sind durch den Frost erst zu wirklichen Nachbarn geworden. Krystallene Brücken und Straßen sind entstanden, und mit einem Schlage entwickelt sich ein so frisches blühendes Winterleben, wie es sich vielleicht nur noch in Holland zeigen kann. Der flüchtige Schlittschuh tritt an die Stelle des beschwerlichen Bauernkahnes, die ganze Bevölkerung erscheint plötzlich beflügelt, wenn auch nur, wie Merkur, an den Füßen. Zwischen den Bauern und Bäuerinnen, die meist gradlinig auf rostigen Eisen dahingleiten und mit ihrer Fahrt irgend einen Zweck verbinden, winden sich Mitglieder der Berliner Eissportvereine in eleganten Bogen hindurch. Wir sehen den Sendboten der nächsten Postanstalt gleichfalls auf Schlittschuhen seines Amtes walten. Für die Jäger ist die Eisdecke auf den labyrinthischen Wasserläufen eine besonders willkommene Erscheinung; jetzt können Inseln jagdmäßig abgetrieben werden, auf denen sonst das Wild geschützt liegt durch brakige Moorgründe, oder der gefrorene Sumpfboden gestattet, das Wild aus seinen Verstecken aufzustöbern und auf die „Blotas“ herauszutreiben, wo es den Feuerrohren verfallen ist.
Höchst seltsam wirkt auf den Fremden ein Leichenbegängniß auf – Schlittschuhen. Wir sind gewohnt, Leidtragende ernst und gemessen einherschreiten zu sehen. Hier erblicken wir eine Reihe wehklagender Schlittschuhläufer in der flottesten rhythmischen Bewegung, die wir sonst nur bei frohen Anlässen beobachteten, und vor ihnen her wird über die weiße Eisfläche ein dunkler Sarg gezogen. Das wirkt befremdend, ja verblüffend. Der seltsame Zug eilt vorüber; die Majestät des Todes spricht auch hier ihre beredte Sprache und hinterläßt vielleicht einen tieferen Eindruck als altgewohnte Trauerbilder.