Abnahme der Solidarität in den Sozialversicherungssystemen: Stellt die Arbeitslosigkeit den bedeutendsten Risikofaktor für Armut dar?
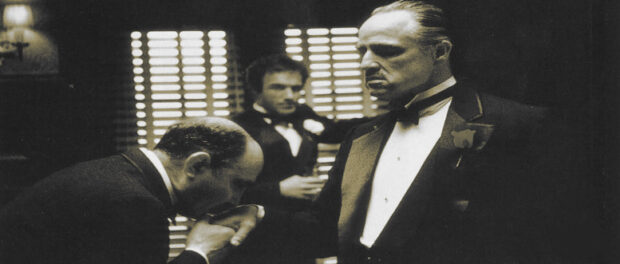 Screenshot youtube.com
Screenshot youtube.com
Nachdem der Bundesrechnungshof im Januar 2002 fehlerhafte Statistiken zur Vermittlung von Arbeitsplätzen durch die Bundesanstalt für Arbeit kritisiert hatte und die Medien dieses Thema aufgriffen, sah sich die Regierung im Wahlkampfjahr 2002 gezwungen, schnell zu handeln. Die Pläne für eine umfassende Reform des Arbeitsmarktes waren zu diesem Zeitpunkt bereits weit fortgeschritten. In enger Zusammenarbeit mit den Unternehmensberatungen McKinsey & Company und Roland Berger Strategy Consultants hatten zentrale Akteure der Regierung Schröder, wie der Chef des Kanzleramts Steinmeier, der spätere Leiter der neu gegründeten Bundesagentur für Arbeit Florian Gerster (SPD) sowie der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit Wolfgang Clement (SPD), bereits frühzeitig einen »Reformfahrplan« in Richtung eines »aktivierenden Sozialstaats« entwickelt. Zu diesem Zweck wurde unter anderem ein Arbeitskreis zur »Reform der Arbeitslosen- und Sozialhilfe« eingerichtet, der bei der Bertelsmann Stiftung angesiedelt war, dortige Projektressourcen erhielt und wissenschaftlich unterstützt wurde. Zudem initiierte die Bertelsmann Stiftung ein Projekt mit dem Titel »Beschäftigungsförderung in Kommunen«.
Nach dem Vermittlungsskandal bei der Bundesanstalt für Arbeit wurde am 22. Februar 2002 das berühmt gewordene Gremium mit dem Namen »Hartz-Kommission«, offiziell »Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt«, unter der Leitung des Personalvorstands von Volkswagen, Peter Hartz, ins Leben gerufen. Nur einen Monat später übernahm ein Vertrauter Schröders die Leitung der neu gegründeten Bundesagentur für Arbeit: Florian Gerster, der mit seinem »Mainzer Modell« eine Ausweitung von Anreizen zur Annahme von Beschäftigungen im Niedriglohnbereich plante und die von ihm als Sozialminister in Rheinland-Pfalz entwickelte Sofortmaßnahme auf ganz Deutschland übertragen wollte. Die Empfehlungen der »Hartz-Kommission«, die aufgrund der Vorarbeiten der Bertelsmann-Arbeitsgruppe bereits sechs Monate nach ihrer Gründung einen Bericht zur Reformierung der Vermittlungstätigkeit und zur Umstrukturierung der Bundesarbeitsagentur vorlegen konnte, fanden auf fruchtbaren Boden.
Nach der knapp gewonnenen Bundestagswahl im September 2002 folgte dem zögerlichen Arbeitsminister Riester der entschlussfreudige Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Wolfgang Clement. Somit wurde die Umsetzung der Arbeitsmarktreformen einem Politiker anvertraut, der später – nach seiner Zeit als »Superminister« für Wirtschaft und Arbeit – aus der SPD austrat und bei der Bundestagswahl 2009 nach eigener Aussage den FDP-Vorsitzenden Guido Westerwelle als Direktkandidaten an seinem Wohnort Bonn mit seiner Erststimme wählte. Das ehemalige politische Schwergewicht ist bis heute nicht nur Kuratoriumsvorsitzender der INSM, sondern sitzt auch im Aufsichtsrat des Zeitarbeitsunternehmens DIS Deutscher Industrie Service, das mittlerweile mehrheitlich dem Schweizer Konkurrenten Adecco gehört, für den Clement das Adecco Institute zur Erforschung der Arbeit leitet. Auch seine weiteren Aufsichtsrats- und Beiratsmandate verdeutlichen, warum dieser ehemalige Politiker und erklärte Gegner eines gesetzlichen Mindestlohns die sozialpolitische Entstaatlichung vorangetrieben hat.
Die unsoziale Wende am Arbeitsmarkt vollzog sich schließlich durch die vier Gesetze für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt, die sogenannten Hartz-Gesetze, welche als größte Reform des Arbeitsmarktes und des Sozialstaates in der deutschen Nachkriegsgeschichte angesehen werden müssen. Während Hartz I unter anderem die flächendeckende Einführung von Personal-Service-Agenturen, Änderungen im Leistungsrecht sowie die Einführung von Bildungsgutscheinen umfasste, wurden mit Hartz II die »Ich-AGs« sowie geringfügige Beschäftigungsverhältnisse (Mini- und Midi-Jobs) und Job-Center etabliert. Mit Hartz III wurde die Bundesanstalt für Arbeit in die Bundesagentur für Arbeit umgewandelt.
Während die ersten drei Hartz-Gesetze nur in wenigen Kreisen auf Widerstand stießen, wurde Hartz IV zur europaweit bekanntesten Chiffre für den Umbau und Abbau des Sozialstaates. Die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe zum sogenannten ALG II kam kaum überraschend: »Wir werden Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fördern und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern müssen.« Mit diesen Worten hatte Gerhard Schröder bereits am 14. März 2003 in seiner Regierungserklärung die deutsche Bevölkerung auf sein neoliberales Reformprogramm eingeschworen, mit dem sich die rot-grüne Koalition endgültig von ihrem sozialdemokratischen Erbe verabschiedete – und auf die Privatisierung von Lebensrisiken setzte.
Die im Rahmen der »Agenda 2010« entwickelten Hartz-Reformen, die bis heute von vielen Marktgläubigen gepriesen werden, stellen einen Tiefpunkt in der deutschen Sozialgeschichte dar. Noch immer sind über sechs Millionen Menschen auf Unterstützung zur Sicherung ihres Existenzminimums angewiesen; die Zahl erwerbstätiger Armer liegt seit Jahren konstant über einer Million. Die Transferleistungen des ALG II reichen oft nicht aus, um das Existenzminimum zu garantieren, geschweige denn das »soziokulturelle Existenzminimum«, sodass sich seit Einführung von Hartz IV die Anzahl an Lebensmitteltafeln mehr als verdoppelt hat. Tausende Ausgabestellen für kostenlose Nahrungsmittel verzeichnen täglich weit über eine Million Bedürftige zur Armenspeisung.
Das Risiko von Arbeitslosigkeit – eines der schwerwiegendsten Lebensrisiken – welches zuvor durch staatliche Sozialversicherungssysteme abgesichert war, trägt heute weitgehend jeder Einzelne selbst. Die Privatisierung sozialer Leistungen wurde insbesondere durch das zum 1. Januar 2005 eingeführte bedarfsorientierte Arbeitslosengeld II sowie durch die gleichzeitige Abschaffung der lohnabhängigen Arbeitslosenhilfe begünstigt. Auch die Verkürzung des Bezugszeitraums des vorhergehenden lohnabhängigen Arbeitslosengeldes (ALG I) auf einige Monate hat Millionen Arbeitnehmer gezwungen, private Rücklagen zu bilden, um im Falle einer Arbeitslosigkeit nicht ins finanzielle Nichts zu fallen.
Ein weiterer sozialpolitischer Fehlgriff stellt die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes dar, welche einen riesigen Markt für Zeit- und Leiharbeit geschaffen hat. Im Zuge der »Agenda 2010« hob die rot-grüne Bundesregierung das sogenannte Synchronisationsverbot in der Leiharbeit auf, wodurch Zeitarbeitsunternehmen ihre Mitarbeiter entsprechend dem Bedarf entleihender Betriebe einstellen und entlassen können. Seitdem haben Firmen unzählige reguläre Arbeitsverhältnisse durch Leiharbeit ersetzt, was dazu geführt hat, dass sich die Aussichten für Zeitarbeiter, jemals wieder als Festangestellte in einem Betrieb Fuß zu fassen, dramatisch verschlechtert haben.




























