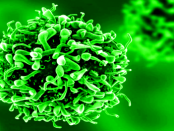Der Pfad hin zu einer Gesellschaft, in der die Altenpflege zunehmend entprofessionalisierte Strukturen annimmt
 Screenshot youtube.com
Screenshot youtube.comDoch wie genau lassen sich eigentlich diese Fachkräfte von den Helfern unterscheiden? Es ist entscheidend, dieses Thema genau zu beleuchten, denn in der Altenpflege hat sich eine ganz besondere Struktur entwickelt. Eine gefährliche Struktur, so warnen zahlreiche Experten. Denn diese Entwicklung könnte düstere Folgen haben – nicht nur für die Altenpflege, sondern auch für die Krankenpflege insgesamt. Was derzeit vor allem ältere Menschen betrifft, könnte in Zukunft alle Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern betreffen.
Beginnen wir von vorne: Bis zur Einführung der generalistischen Ausbildung, die Krankenpflege, Kinderkrankenpflege und Altenpflege nun zusammenfasst, war die Ausbildung zum Altenpfleger eigenständig und dauerte drei Jahre. Da es in der Altenpflege – schon seit vielen Jahren – nicht genügend qualifizierte Fachkräfte gab, während die Zahl pflegebedürftiger Menschen stark anstieg, wurden die Zugangsvoraussetzungen zur Ausübung des Berufs drastisch gesenkt.
Heute arbeiten daher viele Quereinsteiger in Alten- und Pflegeheimen als sogenannte Pflegehelfer oder Pflegeassistenten. Für diese gibt es keine einheitliche Berufsbezeichnung, weil es schlichtweg keine standardisierte Berufsausbildung für sie gibt. Sie durchlaufen keine dreijährige Ausbildung, sondern oft nur kurze Qualifizierungsmaßnahmen von sechs Wochen bis zu ein oder zwei Jahren. In diesem Bereich existiert keine verbindliche Regelung.
Die Inhalte dieser Weiterbildungen werden meist von den Trägern der Heime festgelegt – und finanziell durch Bildungsgutscheine der Arbeitsagentur gefördert. Bildungsgutscheine sind ein beliebtes Mittel, um Langzeitarbeitslose wieder in den Arbeitsmarkt einzubinden oder Menschen vor Arbeitslosigkeit zu bewahren. Der Heimträger erhält vom Staat die Ausbildungskosten erstattet und bekommt im Gegenzug schnell ausgebildete, kostengünstige Mitarbeiter. Das ist ein riesiger Markt und ein gängiger Weg, Menschen in die Altenpflege zu bringen. Aus politischer Sicht hat diese Strategie mehrere Vorteile: Sie verdeckt die durch den Fachkräftemangel entstandene Unterversorgung in vielen Heimen, stabilisiert gleichzeitig die Arbeitslosenstatistik durch neu geschaffene Jobs für Langzeitarbeitslose und sorgt so gleich mehrfach für positive Schlagzeilen.
Grundsätzlich ist es keineswegs schlecht, dass es Helfer in den Heimen gibt, denn sie können viele Aufgaben übernehmen. Es kommt häufig vor, dass das Anreichen einer Mahlzeit bei einem einzigen Bewohner eine ganze Stunde dauert – nur ein Beispiel von vielen. Diese Zeit kann eine Fachkraft dann für pflegeintensivere Tätigkeiten nutzen, wenn jemand die Essensversorgung übernimmt. Über diesen Weg finden viele Menschen mit Herzblut ihren Weg in die Pflege und leisten hervorragende Arbeit. Diese Ausführungen sollen keineswegs ihre Motivation oder Fähigkeiten infrage stellen. Jeder Mensch, der sich für einen Pflegeberuf entscheidet, ist wertvoll und verdient Anerkennung. Problematisch wird es jedoch, wenn der Anteil der Helfer den der Fachkräfte übersteigt – und genau das ist momentan der Trend. Der Anteil der Helfer steigt seit Jahren kontinuierlich an. Rund 48 Prozent aller sozialversicherungspflichtig beschäftigten Altenpflegekräfte sind heute Altenpflegehelfer. In vielen Einrichtungen liegt das Verhältnis bereits bei 60 Prozent Helfern zu 40 Prozent Fachkräften.
Warum ist das gefährlich? Weil dadurch die Professionalisierung des Berufs schleichend ausgehebelt wird. Gute Absichten und ein großes Mitgefühl sind wichtig beim Einstieg in diesen Beruf – doch oft reicht das nicht aus. In bestimmten Bereichen muss man fundiert ausgebildet sein: Man muss Gesundheitszustände erkennen, Veränderungen und Symptome sicher einschätzen und angemessen reagieren können.
Das gilt genauso wie in der Krankenpflege. Man muss Handgriffe beherrschen, sich mit Pharmakologie auskennen sowie Medikamente kompetent dosieren und verabreichen können. Die dreijährige Ausbildung hat ihren guten Grund. In Heimen mit einem höheren Helferanteil übernehmen diese oft mehr Aufgaben als ihnen eigentlich zustehen. Hinter verschlossenen Türen ist das längst bekannt und wird geduldet, weil der Alltag sonst nicht zu bewältigen wäre.
Eine einzelne Fachkraft auf Station kann sich schließlich nicht teilen, um all jene Aufgaben zu erfüllen, die nur von ihr erledigt werden dürfen. Also springen Pflegehelfer ein – mal mehr, mal weniger stark je nach Heim. So etwas dürfte eigentlich nicht passieren; in anderen Berufen würden wir das nicht zulassen! Stellen wir uns vor: Ein ungelernter Mitarbeiter soll eigenständig ein Hausdach fertigstellen oder ein Azubi soll Produktionsmaschinen steuern! Am Menschen lassen wir solche Grenzen verschwimmen – hier scheint das erlaubt zu sein. „Ohne Helfer keine Pflege“ – dieser Satz ist mittlerweile zum geflügelten Wort in der Altenpflege geworden. Er soll Wertschätzung ausdrücken – was gerechtfertigt ist –, zeigt aber auch eindrücklich das Ausmaß des Problems.
Doch es gibt noch ein weiteres übergreifendes Problem: Deprofessionalisierung! Diese findet schon länger in allen Pflegebereichen statt: niedrigere Zugangsvoraussetzungen zur Ausbildung, Abstriche bei den Ausbildungsinhalten sowie mangelhafte Anleitung in der Praxis durch Zeit- und Personalmangel auf den Stationen.
In der Altenpflege kann diese Entwicklung bald zur Einstellung führen: Wenn Helfer mit sechswöchigem Kurs die Versorgung aufrechterhalten können, warum sollte man dann noch eine dreijährige Qualifikation absolvieren? Dahinter steckt auch die Annahme: „Pflege kann doch jeder machen, der das Herz am rechten Fleck hat.“ Dagegen kämpfen wir seit Jahren – nachdem frühere Generationen von Kolleginnen und Kollegen lange dafür gestritten haben, dass eine hochqualifizierte Ausbildung überhaupt etabliert wird.
Am Ende bedeutet weniger Ausbildung auch weniger Gehalt, geringeres Ansehen – aber vor allem deutlich schlechtere Pflegequalität! Deprofessionalisierung ist ein Sparmodell: Sie senkt Personalkosten erheblich. Und Altenpflegehelfer haben kaum Aussichten auf bessere Bezahlung oder mehr Rechte – da sie keinen bundeseinheitlichen Abschluss besitzen und somit de facto keine Berufsgruppe sind. Sie können sich nicht berufsständisch organisieren oder für ihre Interessen eintreten. Was bleibt? Eine billige Arbeitskraft ohne Stimme und Rechte – genau das kommt privaten Fonds und Investoren sehr gelegen, die inzwischen viele deutsche Alten- und Pflegeheime kontrollieren.
Wir gewöhnen uns daran, dass Pflege am Menschen immer mehr zur Massenware verkommt – etwas, an dem man beliebig sparen kann und mit dem beliebig umgegangen wird. Die fehlende Wertschätzung, die überall in der Pflege beklagt wird – zu Recht! –, spiegelt sich genau in diesem Niedergang wider. Vielleicht liegt es aber auch daran: „Hierzulande haben viele Menschen das Gefühl: Altwerden zählt nichts mehr! Alte Menschen bedeuten weder der Gesellschaft noch der Politik etwas – und das schlägt sich eben auch auf die Pflege nieder.“ Im Heim heißt es oft: „Ihr wischt den Menschen doch nur den Hintern ab; sonst macht ihr da doch nichts!“ Wie oft hört man solche Sätze!
Diese Entwicklung findet statt, während gleichzeitig die Anforderungen im Alltag aller Alten- und Pflegeheime steigen: Die Menschen werden insgesamt älter, kränker und vielfach erkrankt (multimorbid). Haben wir etwa einen Bewohner mit 180 Kilo Gewicht, immobil, insulinpflichtig und zusätzlich Clostridien ausscheidend – einen ansteckenden Darmkeim –, dann kann ihn im Spätdienst nicht einmal zu zweit versorgen; dafür braucht man mindestens drei Personen! Dann sind alle Mitarbeitenden im Spätdienst über längere Zeit nur bei einem einzigen Bewohner gebunden.
Die Pflege einzelner Bewohner ist heute oft komplexer als früher; zudem kommen mehr Dokumentation, Schreibtischarbeit, Behandlungspflege sowie organisatorische Aufgaben hinzu – alles Lasten vor allem für Fachkräfte! Ein weiterer Nachteil dieser Entwicklung: Viele haben diesen Beruf ergriffen, um für Menschen da zu sein; doch letztlich sind es besonders oft die Helferinnen und Helfer, die Zeit für die Bewohner haben und nah am Menschen arbeiten.
Fachkraft zu sein bedeutet häufig dennoch wenig Handlungsspielraum zu haben! In Alten- und Pflegeheimen ist meist kein Arzt vor Ort; stattdessen werden Bewohner über Hausarztpraxen betreut. Für jede Kleinigkeit muss eine Verordnung eingeholt werden: Für Voltaren-Einreibungen oder Schmerztabletten ebenso wie für medizinische Einschätzungen. Für selbst banale Verordnungen muss herumtelefoniert werden; bei kritischen Symptomen muss im Zweifel sogar der Rettungsdienst gerufen werden – etwa bei Fieber oder unklaren Schmerzen.
Wenn jemand nicht reagiert, kann das schwerwiegende Folgen haben; doch vom Rettungsdienst gibt es oft unfreundliche Bemerkungen – sie sind schnell genervt von solchen Einsätzen. Doch irgendjemand muss diese Dinge klären; gerade am Wochenende bleibt oft nur die 112 als Option.
Vor allem nachts und an Wochenenden steigen Krankenhauseinweisungen von Heimbewohnern stark an – kein Zufall! Denn dann haben Hausarztpraxen geschlossen und Heime sind meist besonders schlecht besetzt. Auch der Fachkräftemangel trägt dazu bei: Je weniger qualifiziertes Personal vorhanden ist, desto häufiger kommt es zu Klinikeinweisungen.
Ich halte viele dieser Einweisungen für vermeidbar! Dieses Verhalten ist besonders fatal, weil es einen Teufelskreis zwischen Arbeit in Heimen und meiner Tätigkeit auf Intensivstationen oder anderen Krankenhausbereichen schließt: Nicht selten endet eine solche Einweisung mit Komplikationen und stetigem Gesundheitsabbau.
Wir dürfen alte Menschen nicht so behandeln – ebenso wenig wie diejenigen, die sie versorgen! Warum gönnt man pflegebedürftigen Senioren keinen angemessenen Personalschlüssel? Warum gibt es keine bestmöglich ausgebildeten Pflegenden? Warum keine engere ärztliche Betreuung trotz häufigem Bedarf? Warum zeigen wir uns hier nicht großzügiger? Warum akzeptieren wir eine Haltung wie „Zwei Mitarbeitende für 40 pflegebedürftige Senioren reichen völlig“? Warum schätzen wir nicht wertvoll genug jene Menschen, die bereit sind, anderen gerade in den schwierigsten Lebensphasen beizustehen? Warum honorieren wir ihren Einsatz nicht angemessen?
Was sagt all das über uns als Gesellschaft aus? Ich finde: nichts Gutes! Es zeigt aber sehr deutlich auf, wer hier zählt – nämlich Leistungsträger! Es zählen diejenigen mit Effizienz und Agilität sowie jene, die wirtschaftlichen Nutzen bringen. Alte Menschen gehören nach dieser Logik offenbar nicht dazu.
Dabei stimmt das gar nicht; denn es handelt sich um eine sehr große Bevölkerungsgruppe! Und diese Probleme betreffen keineswegs nur ältere Menschen – das ist ein weitverbreiteter Irrtum! Tatsächlich sind viel mehr Menschen aller Altersgruppen betroffen; doch das wird gerne verschwiegen.