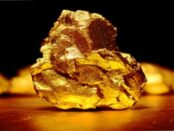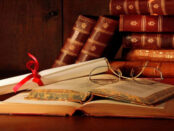Hat das fundamentale Recht auf Privatsphäre seine Relevanz verloren?
 Screenshot youtube.com
Screenshot youtube.com
Wie stark sich die Bedeutung und die Assoziationen von Wörtern doch verändern: Während das Wort »Zigeuner« in meiner Kindheit noch mit Romantik, Freiheit, fröhlicher Musik und Tanz assoziiert wurde, ist es heute nicht mehr akzeptabel, es zu verwenden. Es gilt als politisch inkorrekt. Die negativen Assoziationen, die diesem Begriff und den damit bezeichneten Menschen von der Gesellschaft zugeordnet wurden, sind zu stark. Wer kennt nicht das Volkslied »Lustig ist das Zigeunerleben, faria faria ho.« Generationen von Kindern haben es mit Freude gesungen. Auch die Zeile »Brauchen dem Kaiser kein Zins zu geben, faria, faria, ho« war uns vertraut. Heute ist das Wort »Zigeuner« jedoch ein Tabu. In eine ähnliche Richtung entwickelt sich der Begriff »Privatsphäre«.
Die Freiheit, selbst zu entscheiden, wer welche Informationen über mich hat, wurde von der westlichen Gesellschaft mühsam erkämpft und als erstrebenswerte »Privatsphäre« in die Begriffswelt integriert. Noch vor wenigen Jahren war es für alle politischen Strömungen von rechts bis links selbstverständlich, darüber zu bestimmen, wer welche Informationen über eine Person erhält. Doch mittlerweile beginnt das Wort Privatsphäre bereits einen unangenehmen Beigeschmack zu hinterlassen. Für manche klingt es nach Verkaufsjargon für überteuerte Wohnungen oder nach Ausreden von Menschen, die etwas verbergen möchten – selbstverständlich etwas Unredliches – denn warum sonst sollten sie nicht allen zeigen, was sie besitzen? Die Privatsphäre wird von Behörden, Medien und der Öffentlichkeit als lästiges Hindernis empfunden, wenn es darum geht, an mehr oder weniger interessante oder relevante Informationen über Personen aller Art zu gelangen.
Die Privatsphäre des Individuums stellt an sich einen wertvollen Schatz dar. Dieser Begriff regelt das Verhältnis zwischen dem Einzelnen und dem Staat. Es geht nicht darum, was der Einzelne tun darf, sondern vielmehr darum, was der Staat nicht tun darf. Besonders wichtig ist es, sich ins Gedächtnis zu rufen, warum der Staat bestimmte Dinge nicht tun darf; warum es sinnvoll ist, dass dem Staat Grenzen gesetzt werden – selbst einem Staat, dessen Institutionen demokratischen und rechtsstaatlichen Kontrollen unterliegen. Insbesondere die Europäer, die im 20. Jahrhundert leidvolle Erfahrungen mit autoritären und totalitären Regierungen gemacht haben, haben guten Grund sich für den Erhalt der Privatsphäre und damit für individuelle Freiräume einzusetzen.
Diese Freiräume des Individuums sind nichts anderes als Informationsgrenzen gegenüber dem Staat und der Allgemeinheit. Doch diese Freiräume scheinen durch technologische Entwicklungen, zunehmende staatliche Überwachung, das extrovertierte Verhalten breiter Bevölkerungsschichten (soziale Netzwerke) sowie durch weitere Veränderungen in unseren Gesellschaftsstrukturen einer stetigen Erosion ausgesetzt zu sein. Die Privatsphäre des Einzelnen ist an sich ein kostbares Gut. Es ist auffällig, dass viele Bürger dieser Entwicklung relativ gelassen und manchmal sogar gleichgültig gegenüberstehen. Die Aussage von Scott McNealy, Mitbegründer des Technologieunternehmens Sun Microsystems, könnte stellvertretend für diese Haltung stehen: »Du hast keine Privatsphäre. Doch damit musst du leben.«
Seine Äußerung zeugt nicht von irgendwelchen Ängsten um die Privatsphäre – Ängste wohlgemerkt, die bei einer historischen Betrachtung durchaus angebracht wären. Aus dieser Bemerkung lässt sich entnehmen, dass McNealy die liberalen Gesellschaftsordnungen des Westens als derart stabil einschätzt, dass die Rechte und Freiheiten des einzelnen Bürgers nicht in Gefahr geraten werden – auch nicht in politisch und wirtschaftlich schwierigeren Zeiten.
Die Privatsphäre ist ein Gut, das sich die Menschen über Jahrhunderte hinweg in politischen Auseinandersetzungen erkämpft haben. Die Geschichte Europas ist geprägt von Zeiten, in denen die Freiräume für den einzelnen Bürger gewachsen sind. Allerdings war die Erweiterung der Privatsphäre kein geradliniger Prozess; dramatische Rückschläge unter menschenverachtenden Herrschaftssystemen wie dem Faschismus und Kommunismus zeigen dies deutlich. In solchen ideologisch geprägten Gesellschaften zählt das Individuum in der Regel wenig; die Machthaber haben im Gegenteil alles unternommen, um vollständige Kontrolle über den Einzelnen zu erlangen und ihn einzuschränken. Das bedeutete konkret, dass sie die Privatsphäre überall dort aushöhlten (und nach wie vor aushöhlen), wo es ihnen nützlich war.
Die Privatsphäre ist ein Gut, das sich die Menschen über Jahrhunderte hinweg in politischen Kämpfen erkämpft haben. Wie sehr der Anspruch auf Privatsphäre die Demokratien des Westens prägt, wird deutlich für diejenigen, die einen Blick auf die fehlenden Entfaltungsmöglichkeiten des Individuums in autoritären und totalitären Systemen werfen. In einem totalitären Staat müssen alle dem allmächtigen Staat dienen und gehorchen. Daher wurden auch die Grundrechte des Einzelnen eingeschränkt – darunter das Recht auf freie Meinungsäußerung, das Briefgeheimnis sowie der Schutz vor willkürlichen Hausdurchsuchungen und die Eigentumsrechte politisch Verfolgter.
Auch wenn Anspruch und Realität in diesem totalitären System auseinanderklafften, unternahmen die Nazis dennoch alles Mögliche, um den Einzelnen zu kontrollieren und gleichzuschalten. Dies geschah über Institutionen und Organisationen – unter anderem die Hitlerjugend und den Bund deutscher Mädel – welche zur Gleichschaltung in der Gesellschaft beitrugen. Der Einzelne wurde auch durch ein weit verzweigtes Netz von Spitzeln eingeschränkt: Zu Kriegsbeginn verfügte das Nazi-Regime Schätzungen zufolge über etwa 800 000 Blockwarte sowie zusätzliche Brigaden von Helfern, deren Aufgabe es war herauszufinden, was sich in den einzelnen Haushalten abspielte.
Doch das Nazi-Regime war hinsichtlich der fehlenden Privatsphäre kein Einzelfall. Auch kommunistische Regime respektierten historisch gesehen das Recht auf Privatsphäre in keiner Weise. Denn in diesen Gesellschaftsordnungen zählte nur das Kollektiv – das Individuum hatte sich diesen Rahmenbedingungen zu unterwerfen. Kommunismus bedeutete für die Machthaber nichts anderes als die Gleichschaltung der einzelnen Mitglieder entlang der ideologischen Vorgaben von Staat und Partei. Wer abwich, musste mit brutalen Konsequenzen rechnen – wie dies in den ersten Jahrzehnten nach der Gründung der Sowjetunion millionenfach geschehen ist. Rechte konnte das Individuum in kommunistischen Ländern lange Zeit nicht einfordern; alles wurde nach einem politischen Opportunitätsprinzip entschieden, welches den einzelnen Staatsangehörigen zur Manövriermasse machte. Oft wurden im Hinblick auf das »große Ziel« keinerlei Freiräume für Andersdenkende toleriert. Eine vergleichbare Entwicklung scheint heutzutage stattzufinden.