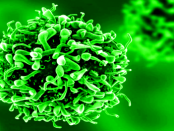Plötzlich Patient – Weshalb wir die Leistungsfähigkeit unseres eigenen Körpers oft zu hoch einschätzen?
 Screenshot youtube.com
Screenshot youtube.com
Vielleicht liegt einer unserer gravierendsten Irrtümer darin, dass wir uns selbst überschätzen. Wir überschätzen den Körper, in dem wir leben, ebenso wie seine Belastbarkeit, seine Fähigkeit, Schmerzen zu ertragen und Widrigkeiten zu verkraften. Wir gehen davon aus, dass alles so bleibt, wie es ist, dass es schon gut ausgeht; dass wir lange leben und gesund bleiben werden.Wir vertreiben die Zeit mit Plänen, sparen für die Rente und denken an das Abendessen. Und dann geschieht etwas Unerwartetes: Ein Auto kommt von rechts, das wir nicht bemerkt haben. Oder in unserem Blut bildet sich ein Gerinnsel, die Niere versagt ihre Funktion, ein lebenswichtiges Gefäß verengt sich, oder eine Pandemie – bis vor Kurzem noch am anderen Ende der Welt – beherrscht plötzlich unser eigenes Land. Dies ist kein Aufruf, sich ständig den Tod vor Augen zu führen. Sondern vielmehr eine Erinnerung an das Leben.
Es gibt unzählige Gründe, warum es großartig ist, Krankenschwester zu sein, und ebenso viele Gründe, warum dieser Beruf unter den gegenwärtigen Bedingungen sehr herausfordernd ist. Doch es gibt noch etwas Besonderes an diesem Beruf – die Quintessenz dessen, was wir täglich erleben und beobachten. Etwas, das uns einen Vorsprung an Wissen verschafft, uns ein Bewusstsein schenkt und uns eine wichtige Wahrheit vor Augen hält. Etwas so Einfaches und vielleicht banal Klingendes, aber dennoch unumstößlich: Das Leben kann jederzeit enden oder zumindest plötzlich eine drastische Wendung nehmen. Für jeden von uns. Ganz gleich, wie stark oder unverwundbar wir uns gerade fühlen. Unabhängig davon, was auf unserer To-do-Liste steht oder welche Termine in der kommenden Woche anstehen.
Wir sind nicht unantastbar – wir sind verletzlich. Wir sind sterblich.An einem Nachmittag kam ein Patient zu uns, 32 Jahre alt, nach einem Sturz aus dem Fenster. Vielleicht war es ein Unfall, vielleicht fiel er herunter, vielleicht wurde er gestoßen oder sprang er tatsächlich selbst. Natürlich dachte jeder daran – doch niemand wusste es genau und ihn konnte man nicht fragen. Er hatte ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten und war intubiert sowie beatmet. Er hatte große Pläne gehabt: In wenigen Monaten wollte er heiraten. Er plante die Hochzeit und eine gemeinsame Reise mit seiner Frau – und nun lag er beatmet auf der Intensivstation. Seine Verlobte kam häufig zu Besuch; sie sprach mit ihm und erinnerte ihn an das Kommende: an die sorgfältig ausgewählten Ringe, die bereits bereitlagen, an die gebuchte Reise und das gemeinsame Leben, das vor ihnen lag.Er hat es nicht geschafft. Er starb. Es war furchtbar traurig.
Solche Situationen begegnen uns täglich: Wir Pflegerinnen und Pfleger, Schwestern und Ärzte sowie alle anderen Mitarbeitenden in Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen sehen jeden Tag Menschen aus dem Leben gerissen werden – wie ihr Leben zerbricht und auch das ihrer Familien auseinanderfällt. Wir erleben die Tiefe dieses Leids und wissen um den Schmerz dahinter.Doch nicht immer wissen wir sofort, was in solchen Momenten das Richtige ist – was wir tun oder sagen sollen. Diese Unsicherheit kennt jeder: Man weiß nicht genau, wie man reagieren soll oder welche Worte angemessen sind. Oft fehlen uns passende Antworten auf Situationen, auf die niemand vorbereitet werden kann. Selbst nach der besten Ausbildung ist man nicht auf alles gefasst. Man lernt zwar auf fallenden oder steigenden Blutdruck zu reagieren, auf entgleisten Blutzucker oder niedrige Sauerstoffsättigung sowie entzündete Wunden oder rasende Herzen.
Das beherrschen wir; hier gibt es richtig oder falsch, Standards, Lehrmeinungen und Leitlinien. Doch dann gibt es jene Momente, die individuell sind – die uns selbst überwältigen und hilflos machen, weil wir keine klaren Handlungsanweisungen haben. In solchen Fällen kommt es ganz auf uns selbst an: auf unsere emotionale Reife und Persönlichkeit oder darauf, was wir in einer plötzlichen Extremsituation spontan entwickeln können. Denn wie viel Reife besitzt man schon mit Anfang zwanzig?
So alt war ich bei meinem ersten Fall, der mich überforderte – der furchtbar war und an dem ich schließlich gewachsen bin. Anfang zwanzig, frisch examiniert und verliebt im ersten Jahr auf der Intensivstation während meines ersten Sommers dort. Ich war wissbegierig und wollte so sicher sowie kompetent werden wie meine erfahrenen Kolleginnen und Kollegen. Während meiner dreijährigen Ausbildung hatte ich bereits dramatische Situationen erlebt: schwere Erkrankungen und Unfälle – auch bei jungen Menschen. Ich hatte diese gesehen und konnte sie emotional einigermaßen verarbeiten. Ich hatte Sterbende begleitet – natürlich auch solche –, aber nicht so; nicht unter solchen Umständen.
Die Patientin war Mitte dreißig alt und litt an einem bösartigen gynäkologischen Tumor mit bereits weit verbreiteten Metastasen in der Lunge, weshalb sie Atemprobleme hatte. Ihr Allgemeinzustand war stark eingeschränkt. Mit etwas mehr Erfahrung hätte ich vermutlich schon bei der Aufnahme erkannt, dass sie sich im Sterbeprozess befand – präfinal, wie wir sagen. Die junge Frau sprach wenig; tagsüber besuchten sie ihr Ehemann und ihre zwei kleinen Töchter häufig; in solchen besonderen Fällen wurden Besuchszeiten gelockert und verlängert. Der Ehemann zeigte sich beeindruckend im Umgang mit den Kindern sowie seiner kranken Frau. In Ausnahmesituationen erwartet man am Krankenbett Tränen sowie Fassungslosigkeit oder Verzweiflung – doch hier herrschte eine friedvolle und liebevolle Atmosphäre während der Familienbesuche.
An einem Abend jedoch alarmierte der Monitor: Herzfrequenz und Blutdruck der Patientin waren erhöht gegenüber dem Üblichen. Ich ging zu ihr hinüber, um nach ihr zu sehen.
„Ist alles in Ordnung?“, fragte ich die zierliche und ausgezehrte Frau. Sie schwitzte; ihre Augen waren tränengefüllt. Das Sprechen fiel ihr sehr schwer. „Ich habe Angst“, sagte sie.
Sie hätte es gar nicht aussprechen müssen; es war offensichtlich in ihrem Gesicht sichtbar – in ihren Augen –, ebenso spiegelten sich diese Gefühle in den Messwerten wider. Was hätte ich ihr sagen sollen? „Alles wird gut“? Das erschien mir unpassend in diesem Moment. Ich stand am Bett und wusste keinen Rat mehr; ich wusste weder was ich sagen noch tun sollte. Ein Stein lag mir im Magen; so unmittelbar war ich noch nie mit der grenzenlosen Angst eines sterbenden Menschen konfrontiert worden. Ich war erst zwanzig Jahre alt; als Berufsanfängerin überwältigte mich diese Situation emotional sehr.
Schließlich nahm ich ihre Hand und sagte: „Ich passe gut auf Sie auf. Sie sind nicht allein.“ So stand ich etwa zehn Minuten da, hielt ihre Hand und tat ansonsten nichts weiter – doch dennoch geschah etwas: Ihre Vitalwerte normalisierten sich allmählich; sie schlief ein.
Diese Erfahrung habe ich nie vergessen – die unermessliche Traurigkeit dieser Geschichte hat mich tief getroffen; sie hat mich auch geprägt und gestärkt zugleich. Denn ich hatte einen Weg gefunden – vermutlich das Einzige Mögliche in dieser Situation: einen einfachen Satz auszusprechen sowie einige Minuten persönliche Zuwendung zu schenken. In diesem Moment war dies alles, was ich geben konnte. Diesen einfachen Satz habe ich mir bewahrt; er ist weder wertend noch prognostisch – doch ich nutze ihn immer wieder in Varianten dort, wo es nötig erscheint – auch gegenüber Angehörigen; denn auch sie benötigen solche Worte.