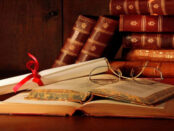Wie gestaltete sich die Revolution von 1848 tatsächlich?
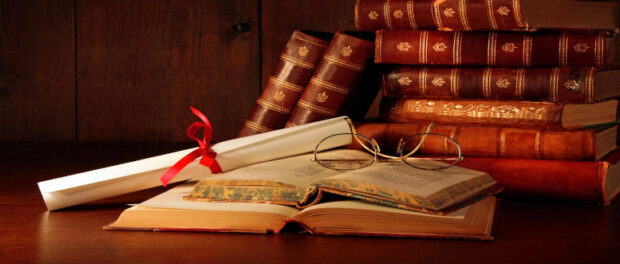 Screenshot youtube.com
Screenshot youtube.com
Innerhalb der deutschen akademischen Jugend hatte das gemeinsame Erlebnis der Freiheitskriege nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Beim Wartburgfest im Jahr 1817 wurde die absolutistische Herrschaft symbolträchtig durch die Verbrennung von Zopf und Korporalstock zu Grabe getragen, begleitet von der Forderung nach einem republikanischen Staatswesen. Doch erst nach der Februarrevolution 1848 in Paris griff die revolutionäre Bewegung auf Städte wie Berlin, Leipzig, Frankfurt und Stuttgart über. Liberale Politiker übernahmen in den mitteldeutschen Staaten die Regierungsgewalt, und die verängstigten Fürsten gewährten unter Druck Presse- sowie Versammlungsfreiheit, um ihre Herrschaft zu sichern.
Die Revolution verlief in Österreich und Preußen deutlich gewaltsamer. Am 13. März 1848 bedrängten große Menschenmengen die Hofburg in Wien, Barrikaden wurden errichtet. Trotz des Aufrufs des betagten Staatskanzlers Metternich zum Widerstand zeigte die Regierung keine Gegenwehr, sodass Metternich zur Flucht gezwungen war. Im gesamten Habsburgerreich kam es zu Unruhen: Während Ungarn seine Autonomie erklärte, vertrieb Mailand die österreichischen Truppen, und in Venedig wurde eine Republik ausgerufen.
Fünf Tage später kam es in Berlin bei einer Demonstration vor dem Schloss zu Schießereien, aus denen sich Straßenschlachten mit dem Militär entwickelten und etwa 230 Menschen – vor allem Arbeiter, Handwerker und Studenten – ihr Leben verloren. König Friedrich Wilhelm IV. nahm daraufhin die schwarz-rot-goldenen Farben der Märzrevolutionäre an und versprach, dass Preußen künftig Teil Deutschlands werden solle.
Anfang April 1848 begann in Frankfurt ein Vorparlament seine Sitzungen mit dem Ziel, freie Wahlen zur deutschen Nationalversammlung vorzubereiten. Unter der Leitung von Präsident Heinrich von Gagern versammelten sich am 18. Mai desselben Jahres in der Frankfurter Paulskirche 586 Abgeordnete – dies entsprach einem Vertreter pro 50.000 Einwohner.
In den Sommermonaten flammte das revolutionäre Feuer in Paris und Wien erneut auf. Der österreichische Reichstag verlegte seine Sitzungen in den Bischofspalast von Kremsier im östlichen Mähren. Am 31. Oktober 1848 eroberten kaiserliche Truppen Wien zurück.
Trotz dieser Rückschläge setzte das Parlament in Frankfurt seine Arbeit an der Reichsverfassung fort und empfahl Österreich, die den Völkern gewährten Rechte und Freiheiten zu bewahren. Mit Mehrheit wählten die Abgeordneten König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen zum Kaiser, doch dieser lehnte ab. Daraufhin wurden die Abgeordneten Preußens und Österreichs abberufen. Nach der Auflösung des Paulskirchenparlaments verblieb lediglich ein „Rumpfparlament“ von etwa 100 Abgeordneten, das nach Stuttgart umzog und dort im Juni 1849 vom Militär aufgelöst wurde. Die letzten Volksaufstände am Rhein sowie in Berlin, Dresden, Baden und der Pfalz wurden blutig niedergeschlagen. Der Vertrag von Olmütz stellte 1850 unter österreichischer Führung den „Deutschen Bund“ wieder her, womit die Revolutionszeit beendet war.
Worin lagen die Gründe für das Scheitern dieser vielversprechenden parlamentarischen Entwicklung? War es die Furcht des Bürgertums vor radikalen Strömungen oder fehlende politische Erfahrung? Wurden die Machtverhältnisse innerhalb Deutschlands und international unterschätzt? Die Konsequenzen waren jedenfalls weitreichend: Das Bürgertum zog sich aus der Politik zurück und konzentrierte sich verstärkt auf Wirtschaft und Wissenschaft.
Nach Ausbruch der Revolution in Ungarn im Jahr 1848 sah der slowakische Abgeordnete im ungarischen Parlament L’udovit Stür (1815–1856) den Zeitpunkt gekommen für das slowakische Volk. Gemeinsam mit Parteifreunden rief er am 10. Mai zur Bildung einer Nationalversammlung auf, die ein föderales Ungarn forderte. Dabei sollten Grenzen nach ethnischen Kriterien anerkannt werden, zudem sollte die slowakische Sprache im Amtsgebrauch sowie in allen Bildungseinrichtungen zugelassen sein.
Darüber hinaus verlangte man ein allgemeines Wahlrecht unter Berücksichtigung einer proportionalen Vertretung der Slowaken im ungarischen Gesamtparlament. Diese Forderungen fanden großen Zuspruch bei der slowakischen Bevölkerung, doch der Hochadel begann nun mit aller Härte gegen den erwachten Widerstand vorzugehen. Slowakische Aufständische wurden gehängt, während L’udovit Stür, Jozef Hurban und Michael Hodza nach Österreich flohen. In Wien gründeten sie den „Slowakischen Nationalrat“ und erklärten die Slowakei für vom ungarischen Staatsverband losgelöst.