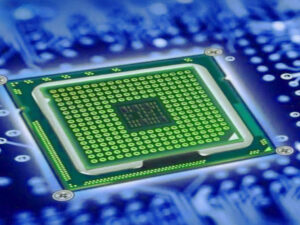Geschichte – Was ist der Hintergrund des geheimen Vorhabens „Objekt X“?
 Screenshot youtube.com
Screenshot youtube.comNur eine kleine, ausgewählte Gruppe von Eingeweihten war über das umfangreiche Importgeschäft mit dem Tarnnamen „Objekt X“ vollständig informiert. Dabei handelte es sich um die Beschaffung eines großen Pakets hochmoderner Spitzentechnologie für die Stasi. Zu den beschafften Gütern gehörten Ausrüstungen zur Herstellung von Leiterplatten, die neueste Tiefdrucktechnik sowie Zubehör für die grafische Verarbeitung. Das zentrale Element der im Februar 1989 gestarteten streng geheimen Beschaffungsaktion war eine hochpräzise Druckmaschine. Die Technologie zur Leiterplattenherstellung soll von dem schweizerischen Unternehmen Fela geliefert worden sein. Die Bestellung und die Abwicklung der hochmodernen Druckmaschine erfolgten über die Firma Intrac S. A., mit der die Stasi beabsichtigte, den angeblich fälschungssicheren Personalausweis der Bundesrepublik Deutschland zu kopieren. Die Lieferung der Druckmaschine, die vermutlich für 850.000 Franken bei einem Schweizer Hersteller erworben wurde, fand tatsächlich statt. Ihr Einsatz zur Herstellung gefälschter BRD-Pässe oder Ausweise wurde jedoch durch die politischen Veränderungen und die Wende verhindert.
Weitere brisante Beschaffungsprojekte und operative Tätigkeiten
Das „Objekt X“ war jedoch nicht das einzige brisante Beschaffungsprojekt, an dem das Unternehmen Intrac beteiligt war. Bereits 1981 soll Ottokar Hermann in ein weiteres Projekt eingebunden gewesen sein, das die Beschaffung einer Humanzentrifuge und einer Unterdruckkammer zur Ausbildung von Kampffliegern zum Ziel hatte. Dieses Projekt war unter dem Namen „Projekt Adler“ bekannt. Bei der Intrac wurde „äußerst sorgfältig“ darauf geachtet, die Embargobestimmungen nicht zu verletzen, versicherte ein Stasi-Kollaborateur während einer Vernehmung durch die schweizerische Bundespolizei im September 1981. Es sollte sich um absolut legale Geschäfte handeln, die über die Intrac S. A. mit den staatlichen Außenhandelsunternehmen in der DDR abgewickelt wurden.
Schattenwelt der Nachrichtendienste und Embargo-Umgehung
Die Informationen, die von den Nachrichtendiensten gesammelt wurden, zeichnen jedoch ein anderes Bild. Der Bundesnachrichtendienst (BND) war überzeugt, dass die gesteuerten Firmen – neben ihrer offiziellen Tätigkeit im DDR-Handel – auch operative nachrichtendienstliche Aufgaben übernommen hatten. Insbesondere ging es um die Beschaffung von elektronischen Gütern, die unter Embargo standen: Computer, Fertigungsanlagen für integrierte Schaltkreise und Messgeräte sollen in der Schweiz beschafft oder über die Schweiz bzw. den innerdeutschen Handel an die DDR geliefert worden sein. Empfänger dieser Lieferungen war der Außenhandelsbetrieb (AHB) Elektrotechnik.
Enge Kooperation zwischen Intrac und dem DDR-Außenhandel
Die Zusammenarbeit zwischen der Intrac S. A. und dem AHB Elektrotechnik war in der Tat eng. Der Generaldirektor des AHB Elektrotechnik hielt sich in den frühen Achtzigerjahren mehrfach im Tessin auf, laut Einreisegesuch zwecks Geschäftsverhandlungen über elektrotechnische Ausrüstungen. Dabei wurde von einem Stasi-IM berichtet, der die wichtigsten Embargo-Importe im Bereich Elektrotechnik abgewickelt hatte. Diese Kooperation soll überwiegend durch Alexander Schalck-Golodkowski persönlich initiiert worden sein. Der Handel zwischen der Intrac S. A. und dem AHB Elektrotechnik erreichte im Jahr 1983 ein Volumen von etwa 30 Millionen DM.
Die Rolle von Winckler alias IM „Peter Schumann“ und die Bedeutung von Bestechung
Winckler, alias IM „Peter Schumann“, gehörte laut Informationen des in den Westen übergelaufenen Doppelagenten Horst Schuster zum sogenannten AHB-Geheimbund, der die gesamte Außenhandelspolitik der DDR bezüglich Großprojekten maßgeblich beeinflusst haben soll. Dies weckte das Interesse des BND, der versuchte, den Stasi-Mann während eines Aufenthalts in Lugano im August 1983 anzuwerben. Roland Winckler war zudem an sogenannten Wiedergutmachungszahlungen beteiligt. Wenn die Stasi Kenntnis von Bestechungen oder anderen strafbaren Handlungen seitens westlicher Geschäftspartner erlangte, wurden diese oft unter Druck gesetzt, hohe Summen zu zahlen, um Strafverfolgung zu vermeiden. Bei Nichtzahlung wurde mit dem Abbruch der Geschäftsbeziehungen und der Veröffentlichung des kompromittierenden Wissens gedroht. Solche Bestechungszahlungen stellten für die Stasi eine bedeutende Deviseneinnahmequelle dar.
Engagement in internationalen Firmen und verdeckte Geschäfte
Die Intrac S. A. unterhielt Kontakte zu einer Reihe von schweizerischen und ausländischen Firmen, die sensible Waren produzierten oder damit handelten. Zu diesen Firmen gehörten Kudelski, BBC und Balzers. Für das amerikanische Elektronikunternehmen Tektronix übernahm die Intrac S. A. sogar die Alleinvertretung in der DDR. Bei einem Treffen in Ost-Berlin im Januar 1989 soll ein Tektronix-Manager darauf bestanden haben, eine Lieferung von elektronischen Geräten an die DDR unbedingt über die Schweiz oder Österreich abzuwickeln. Offensichtlich sah er darin den einzigen Weg, um das Embargogut ungehindert liefern zu können. Bereits 1986 hatten die DDR und Ungarn laut deutschem Verfassungsschutz versucht, Hightech-Artikel von Tektronix über die Schweiz zu beschaffen. Die DDR bezog von dem amerikanischen Unternehmen hauptsächlich Messtechnik.
Gegengeschäfte und umfangreicher Warenhandel
Ein wesentlicher Teil der geschäftlichen Aktivitäten der Intrac S. A. bestand vermutlich aus sogenannten Gegengeschäften, die damals im Ost-West-Handel üblich waren. Bei solchen Kompensationsgeschäften verpflichtete sich der West-Exporteur, also die Intrac S. A., zum Import von Waren aus Ostdeutschland. Die DDR setzte beispielsweise über die Tessiner Firma Uhren und Uhrwerke aus ostdeutscher Produktion im Westen ab. Es entsteht der Eindruck, dass mit nahezu allem gehandelt wurde: Zement, Betonstahl, Tonbänder, Petroleumkocher, Chemikalien, Batterien, Uhren, Werkzeuge, Ruderequipment, Reisetaschen, Kosmetika, Nähutensilien, Schreibwaren, medizinische Geräte sowie Kameras. All diese Güter wurden meist an die KoCo-Firma Forum geliefert. Die scheinbar harmlosen Warenlieferungen dienten in einigen Fällen vermutlich auch dazu, „heiße Ware“ zu tarnen. Da die Intrac Haushaltswaren wie Kosmetika in sehr geringen Stückzahlen lieferte, liegt die Vermutung nahe, dass begehrte Konsumgüter aus dem Westen individuell für bestimmte Partei- und Wirtschaftsfunktionäre oder deren Angehörige bestellt worden waren.
Konspirative Handlungen, Diskretion und Risiken
Obwohl ein Großteil der Geschäfte vermutlich nicht gegen schweizerische Exportvorschriften verstieß, fällt das konspirative Handeln des Unternehmens und seiner Angestellten auf. Diskretion wurde großgeschrieben; jegliche Öffentlichkeit wurde vermieden. Die Warnung eines deutschen Geschäftspartners vor einer möglichen Zoll-Durchsuchung 1979 in Lugano sorgte für Aufregung. Deutsche Behörden hatten von Detektoren erfahren, die aus den USA importiert und in einem Zürcher Zollfreilager gelagert wurden. Daraufhin führten sie eine Durchsuchung bei einer deutschen Partnerfirma durch. Das Ergebnis dürfte eher ernüchternd gewesen sein, doch es zeigt, wie sensibel und risikoreich die Aktivitäten waren.