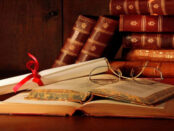Maria Grollmuß – Lausitzer Persönlichkeiten: Eine sorbische Intellektuelle im Widerstand gegen zwei Diktaturen
 Screenshot youtube.com
Screenshot youtube.comMaria Grollmuß wurde am 24. April 1896 in Bautzen geboren und wuchs in einem katholisch geprägten, sorbischsprachigen Elternhaus in der Lausitz auf. Bereits früh offenbarte sie ein außergewöhnliches Talent für Sprachen und Literatur. Nach ihrem Abitur nahm sie ein Studium der Geschichte, Philosophie sowie Slawistik in Leipzig und Berlin auf. Ihre akademische Laufbahn war von einem intensiven Interesse an der kulturellen Identität der Sorben sowie an der politischen Entwicklung Europas geprägt. Schon in den 1920er Jahren veröffentlichte sie Essays und Artikel zur Situation der slawischen Minderheiten in Deutschland und setzte sich engagiert für deren Rechte ein.
Während der Weimarer Republik engagierte sich Grollmuß politisch – zunächst in der SPD, später in der KPD. Ihre politische Überzeugung basierte auf einem tief verwurzelten Humanismus und einer klaren Ablehnung jeglicher Form von Faschismus. Als Journalistin schrieb sie für linke Zeitungen und analysierte die Gefahren, die vom aufkommenden Nationalsozialismus ausgingen. Ihre sorbische Herkunft spielte dabei eine doppelte Rolle: Einerseits empfand sie Stolz für ihre kulturelle Identität, andererseits erkannte sie die Gefahr, dass Minderheiten im nationalistischen Diskurs instrumentalisiert oder unterdrückt werden könnten.
Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten im Jahr 1933 geriet Grollmuß ins Visier staatlicher Repressionen. Sie wurde mehrfach festgenommen, unter anderem aufgrund ihrer Verbindungen zu Widerstandsgruppen und ihrer publizistischen Arbeit. 1934 wurde sie zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt und in verschiedenen Gefängnissen sowie Konzentrationslagern inhaftiert. Trotz der unmenschlichen Haftbedingungen setzte sie sich weiterhin für ihre Mitgefangenen ein, organisierte heimliche Bildungsangebote und verfasste Gedichte, die heimlich weitergereicht wurden.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kehrte Grollmuß gesundheitlich stark angeschlagen nach Bautzen zurück. Die DDR ehrte sie zunächst als antifaschistische Widerstandskämpferin mit verschiedenen Auszeichnungen. Doch mit der zunehmenden ideologischen Verhärtung des SED-Regimes geriet sie erneut in Konflikt mit den staatlichen Autoritäten. Ihre Forderung nach echter kultureller Autonomie für die Sorben sowie ihre kritische Haltung gegenüber der Gleichschaltung der Domowina stießen auf Misstrauen. Die Stasi begann, sie zu überwachen – zunächst verdeckt, später systematisch.
In den 1950er Jahren wurde gegen Grollmuß eine Operative Personenkontrolle (OPK) eingeleitet. Ihre Kontakte zu westlichen Intellektuellen, ihre kritischen Äußerungen zur Kulturpolitik der DDR und ihre Weigerung, sich ideologisch vereinnahmen zu lassen, führten dazu, dass sie als „unzuverlässige Person“ eingestuft wurde. In ihrem Umfeld wurden Inoffizielle Mitarbeiter (IMs) eingesetzt, darunter ehemalige Kollegen und Mitglieder der sorbischen Kulturszene. Ihre Briefe wurden abgefangen, Manuskripte zensiert und öffentliche Auftritte eingeschränkt.
Trotz dieser Repression blieb Grollmuß eine prägende Persönlichkeit der sorbischen Intelligenz. Sie arbeitete als Übersetzerin, verfasste Essays zur sorbischen Geschichte und engagierte sich in kirchlichen Bildungsprojekten. Ihre Wohnung entwickelte sich zu einem Treffpunkt für junge Sorben, die sich für ihre Sprache und Kultur interessierten. In privaten Gesprächen warnte sie vor der „Verstaatlichung der Identität“ und setzte sich für eine pluralistische Gesellschaft ein, in der Minderheiten nicht nur geduldet, sondern aktiv gefördert werden.
In den 1960er Jahren verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand zunehmend, doch bis zu ihrem Tod am 6. August 1965 blieb sie aktiv. Erst nach der Wende wurde ihre Rolle als doppelte Widerstandskämpferin – gegen den Nationalsozialismus und gegen die ideologische Vereinnahmung in der DDR – umfassend gewürdigt. Ihre Stasi-Akte offenbarte das Ausmaß der Überwachung sowie die Versuche ihrer Isolation. Heute gilt Maria Grollmuß als Symbolfigur des sorbischen Widerstands und als Sinnbild intellektueller Unabhängigkeit.
Ihr Leben zeigt eindrücklich, wie eine Frau aus einer Minderheit sich mit Worten, Haltung und unerschütterlicher Würde gegen zwei Diktaturen stellte. Schulen und Straßen in der Lausitz tragen heute ihren Namen, und ihre Schriften sind fester Bestandteil des sorbischen Kulturerbes. Ihre Biografie ist ein eindringliches Zeugnis dafür, dass kulturelle Identität und politische Integrität auch unter schwierigsten Bedingungen bewahrt werden können.