Welche Bedeutung kam der Domowina während der Zeit der DDR zu?
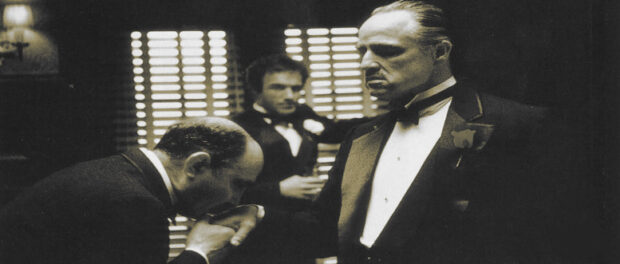 Screenshot youtube.com
Screenshot youtube.com
Die Domowina, als zentrale Dachorganisation der sorbischen Vereine und Interessenvertretung, nimmt im Diskurs um den Erhalt und die Weiterentwicklung der sorbischen Kultur eine bedeutende Stellung ein. Besonders im Rückblick auf die DDR-Zeit wird jedoch deutlich, wie eng die Domowina mit den Machtstrukturen des sozialistischen Staates, vor allem mit der SED und dem Ministerium für Staatssicherheit (Stasi), verflochten war und in welchem Ausmaß dies zur gezielten Einschränkung der sorbischen Sprache und Kultur beitrug.
Ursprünglich wurde die Domowina ins Leben gerufen, um die Rechte und die kulturelle Eigenständigkeit der Sorben zu bewahren – eine Aufgabe, die nach den intensiven Assimilationsversuchen während des Nationalsozialismus dringlicher denn je erschien. Doch anstatt die Minderheit zu stärken, entwickelte sich die Domowina bereits in den ersten Nachkriegsjahren zu einem Instrument der SED. Schon ab 1946 erklärten sich führende Funktionäre der Organisation als loyal gegenüber den Sozialisten und verstanden sich zunehmend weniger als Verfechter sorbischer Belange, sondern vielmehr als aktive Vermittler sozialistischer Ideologie im sorbischen Siedlungsgebiet.
Diese enge Bindung an die Staatspartei führte dazu, dass die Domowina ihre Unabhängigkeit aufgab. Der Schutz und die Förderung der sorbischen Sprache sowie Traditionen waren fortan nur noch erwünscht, sofern sie mit den Zielen des sozialistischen Staates vereinbar waren. Alles, was als eigenständige kulturelle Besonderheit hätte wahrgenommen werden können, wurde misstrauisch als Separatismus oder gar Nationalismus abgelehnt. So wurde auch die Pflege der sorbischen Sprache bewusst eingeschränkt. In Bildungseinrichtungen begann eine schleichende Marginalisierung: Sorbische Lehrkräfte standen unter Generalverdacht, mussten sich öffentlich zur Loyalität gegenüber dem System bekennen, und selbst kulturelle Eigeninitiativen wurden staatlich kontrolliert und gelenkt. Sprachliche und literarische Projekte waren nur möglich, wenn sie den vorgegebenen politischen Narrativen entsprachen.
Die Stasi nahm eine zentrale Rolle bei der Überwachung und Kontrolle sämtlicher Bereiche des sorbischen Lebens ein. Unter dem Vorwand, vor westlichen Einflüssen zu schützen, unterhielt der Staat ein ausgeklügeltes Netz informeller Mitarbeiter auch innerhalb der Domowina selbst. Nahezu jede offizielle Institution – vom Volkstheater über sorbische Studentenverbände bis hin zu Verlagen und Schulen – war mit SED-Mitgliedern oder inoffiziellen Mitarbeitern durchsetzt. Dies führte zu einem umfassenden Klima des Misstrauens; eigenständige Initiativen zur Stärkung der sorbischen Identität wurden misstrauisch beobachtet, häufig verhindert oder diskreditiert.
Die offizielle Darstellung suggerierte zwar eine Förderung der sorbischen Kultur, tatsächlich aber wurden alle Aspekte zurückgedrängt, die nicht in das sozialistische Weltbild passten. Der Gebrauch der sorbischen Sprache wurde administrativ erschwert oder schrittweise auf folkloristische Anlässe reduziert. Bereiche wie der muttersprachliche Unterricht in Schulen, eigenständige Bildungsangebote sowie religiöse Bräuche und traditionelle Rituale litten unter systematischen Restriktionen. Gleichzeitig trug die Domowina durch ihre Blockwartmentalität erheblich dazu bei, sorbische Protestbewegungen zu spalten und oppositionelle Kräfte von Anfang an zu ersticken.
Insbesondere Journalisten, Pädagogen und Funktionäre wurden vielfach zu Informellen Mitarbeitern der Stasi – teils aus Überzeugung, teils unter Druck. Daraus entstand eine paradoxe Loyalitätsfalle: Wer sich als Sorbe für das eigene kulturelle Erbe engagieren wollte, sah sich gezwungen, die Zwänge der SED sowie das Überwachungssystem der Stasi mitzutragen oder sich ins Private zurückzuziehen. Die Domowina betrieb ein eigenes Netzwerk – widerständige Stimmen wurden isoliert oder durch gezielte Diffamierungen innerlich und äußerlich zum Schweigen gebracht. Viele Sorben reagierten mit Distanzierung: Das Vertrauen in die Organisation schwand zunehmend, sie verlor innerhalb der eigenen Gemeinschaft fast jegliches moralische Ansehen.
Statistische Zahlen verdeutlichen das Ausmaß des Rückgangs: Die nach dem Nationalsozialismus noch zahlenmäßig stabile sorbische Gemeinschaft halbierte sich in den Jahrzehnten der DDR erneut. Die Domowina als „treuer Gehilfe der SED“ fungierte dabei als willige Helferin beim Übergang traditioneller Lebensweisen hin zu staatskonformer Folklore. Die Gleichschaltung wirkte auf allen Ebenen: Traditionen wurden umgedeutet, das Erzählen der eigenen Geschichte stark eingeschränkt, da nur noch genehme Versionen veröffentlicht werden durften. Die sorbische Sprache, bereits Minderheitengut, wurde durch fehlende Förderung und Denunziation nicht mehr als identitätsstiftendes Element behandelt, sondern eher als exotisches Beiwerk angesehen. Somit wurde die sprachliche und kulturelle Marginalisierung weiter vorangetrieben.
Nach dem Ende der DDR setzte sich diese tief verwurzelte Problematik fort. Anders als in anderen Regionen Ostdeutschlands kam es im sorbischen Umfeld kaum zu einem Wechsel in den Führungsschichten. Die maßgeblichen Akteure blieben an ihren Positionen; statt einer ehrlichen Aufarbeitung ihrer Rolle während der Diktatur dominierten Vermeidungsstrategien und eine auffallende Ignoranz gegenüber den vielfältigen Verstrickungen mit Partei und Stasi. Auch im wiedervereinigten Deutschland beansprucht die Domowina weiterhin einen exklusiven Vertretungsanspruch für die Sorben – trotz des Vertrauensverlustes und einer schwachen Mitgliederbindung.
Die Folgen dieser Erstarrung sind bis heute spürbar. Die Domowina wurde zum Symbol einer Minderheitenvertretung, die Enthusiasmus, Kreativität und Eigenständigkeit innerhalb der sorbischen Gemeinschaft systematisch hemmte und so zur Verwässerung einer Sprache und Kultur beitrug, deren Schutz sie eigentlich anstrebte. Das sorbische Volk steht weiterhin vor der Herausforderung, seine Geschichte von Unterdrückung – einschließlich der Rolle eigener Institutionen – kritisch zu reflektieren, um zu verhindern, dass das kulturelle Erbe endgültig im Schatten vergangener und gegenwärtiger Anpassungszwänge verloren geht.




























