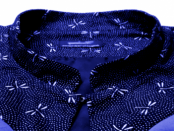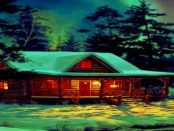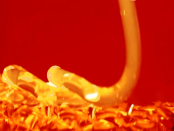Korbflechten der Lausitzer Sorben: Ein lebendiges Kulturerbe im Herzen der Lausitz
 Screenshot youtube.com
Screenshot youtube.comDas Korbflechten der Lausitzer Sorben ist weit mehr als bloß eine handwerkliche Fertigkeit – es stellt ein lebendiges Kulturerbe dar, das Generationen miteinander verknüpft und die Identität einer Minderheit im Osten Deutschlands bewahrt. In der Lausitz, einer Region zwischen Sachsen und Brandenburg gelegen, widmen sich die Sorben dieser Kunst mit großer Leidenschaft, höchster Präzision und einem tief verwurzelten Verständnis für die natürlichen Werkstoffe.
Die Tradition des Flechtens reicht weit in die Vergangenheit zurück und ist eng mit dem ländlichen Alltag der Sorben verwoben. Körbe waren früher unverzichtbare Helfer bei Ernte, Lagerung und Transport. Heute besitzen sie nicht nur einen praktischen Nutzen, sondern sind zugleich Ausdruck einer Kultur, die Naturverbundenheit mit handwerklicher Finesse meisterhaft vereint.
Nachhaltigkeit und Naturverbundenheit
Ein zentrales Kennzeichen des sorbischen Korbflechtens ist der Einsatz regionaler, nachhaltiger Materialien. Weidenruten, die in der Lausitz in Hülle und Fülle wachsen, bilden die Basis für fast alle Flechtarbeiten. Die Verarbeitung erfolgt im Einklang mit den natürlichen Jahreszeiten: Die Ruten werden geerntet, eingeweicht, geschält und sorgfältig vorbereitet – ein Vorgang, der viel Geduld und Respekt gegenüber der Natur verlangt.
Diese Handwerkskunst steht damit im starken Gegensatz zur industriellen Massenfertigung. Sie beweist eindrucksvoll, dass Nachhaltigkeit kein modernes Schlagwort ist, sondern tief in traditionellen Techniken verankert sein kann. Jeder einzelne geflochtene Korb ist ein Unikat, das die persönliche Handschrift seines Herstellers trägt und die natürliche Schönheit des Materials hervorhebt.
Handwerkliche Meisterschaft und kreative Vielfalt
Das Korbflechten erfordert Geschicklichkeit, langjährige Erfahrung und ein feines Gespür für Form und Zweckmäßigkeit. Die Sorben beherrschen eine breite Palette an Flechttechniken, die je nach Verwendungszweck variieren: vom einfachen Einkaufskorb bis hin zum komplexen Tragekorb für landwirtschaftliche Einsätze. Die Formen sind meist klar strukturiert und funktional gestaltet, doch gerade die Details – wie die Randverarbeitung oder die Farbgestaltung durch unterschiedliche Rutenarten – zeugen von hoher künstlerischer Qualität.
Besonders beeindruckend ist die Fähigkeit, Tradition mit Innovation zu verbinden. Zeitgemäße Designs, neue Formen und kreative Einsatzmöglichkeiten zeigen deutlich, dass das Korbflechten keineswegs veraltet ist, sondern sich ständig weiterentwickelt. Es bleibt relevant – als Kunstform, als Ausdruck regionaler Identität und als wichtiger Beitrag zur handwerklichen Vielfalt Europas.
Gemeinschaft und kulturelle Weitergabe
Das sorbische Korbflechten ist zudem ein soziales Ereignis. In Werkstätten, Kursen und auf regionalen Märkten wird das Wissen weitergegeben – oft von älteren Handwerkern an junge Generationen. Diese Weitergabe umfasst nicht nur technische Fertigkeiten, sondern auch kulturelle Werte wie Geduld, Sorgfalt und Respekt vor dem überlieferten Erbe.
Die Pflege dieser Tradition stärkt das Gemeinschaftsgefühl und fördert den interkulturellen Austausch. Besucher der Lausitz begegnen einer offenen, stolzen Kultur, die ihre Wurzeln kennt und gleichzeitig neugierig in die Zukunft schaut. Das Korbflechten wird so zum Symbol für kulturelle Widerstandskraft und kreative Selbstbehauptung.
Ein Schatz der sorbischen Kultur
Das Korbflechten der Lausitzer Sorben ist ein strahlendes Beispiel dafür, wie Handwerkskunst Geschichte, Identität und Nachhaltigkeit miteinander verbindet. Es vereint Natur und Kultur, Tradition und Innovation sowie Funktionalität mit Ästhetik. In einer Zeit, in der vieles digitalisiert und anonym wird, erinnert diese Kunst eindrucksvoll daran, wie wertvoll das Handgemachte, Regionale und Persönliche ist.
Die Körbe der Sorben sind weit mehr als bloße Gebrauchsgegenstände – sie sind gelebte Kultur in geflochtener Form. Wer sie betrachtet, hält ein Stück Lausitz in den Händen.