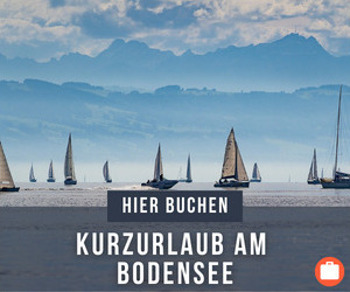Wie das Urheberrecht physische Dinge unbrauchbar macht
 Screenshot youtube.com
Screenshot youtube.comDas Urheberrecht entwickelt sich aufgrund des Einflusses von Lobbyisten und fragwürdiger Gerichtsentscheidungen allmählich zu einer Art “Superrecht” für Profitzwecke. Die Auswirkungen davon haben längst die immaterielle Welt von Büchern, Musik, Kunst usw. verlassen und breiten sich zunehmend in der realen Welt aus. Auch wenn den Webseite mittlerweile wieder erreichbar ist.
“Deutsche (IPv4-)Adressen für das US-Portal ‘Project Gutenberg’ bis auf weiteres blockiert sind”
„Die Literary Archive Foundation erklärt, dass deutsche (IPv4-)Adressen für das US-Portal ‘Project Gutenberg’ bis auf weiteres blockiert sind. Diese Maßnahme geht auf einen verlorenen Urheberrechtsstreit vor dem Landgericht Frankfurt am Main zurück. Geklagt hatte der S. Fischer Verlag, der seine Rechte wegen 18 auf der Seite www.gutenberg.org veröffentlichten E-Books deutscher Autoren verletzt sah. Er forderte, die Bereitstellung der Titel online zu unterlassen. So heißt es in einem entsprechenden Gerichtsurteil, das Anfang Februar verkündet wurde. Das Project Gutenberg (PG) ist eine 1971 vom US-Amerikaner Michael S. Hart gegründete, über das Internet zugängliche und von Freiwilligen erstellte digitale Bibliothek.”
“Project Gutenberg (PG) ist eine 1971 vom US-Amerikaner Michael S. Hart gegründete”
Auf der Webseite des Projekts stehen zahlreiche englischsprachige E-Books zum kostenlosen Lesen und Herunterladen zur Verfügung. Das Partnerprojekt Gutenberg bietet hauptsächlich deutschsprachige Literatur an. Laut Urteil (AZ: 2-03 O 494/14) hat die Website die Rechte des S. Fischer Verlags verletzt, was zu einem drohenden Ordnungsgeld für die Literary Archive Foundation führen könnte, welche das Projekt Gutenberg betreibt. Der Streit drehte sich um digitalisierte Werke von Heinrich Mann wie “Der Untertan”, Thomas Manns “Die Buddenbrooks” oder “Der Tod in Venedig” sowie Alfred Döblins Werke wie “Wallenstein”.
Teils sehr unterschiedliche Vorstellungen von Urheberrecht
Die Kontroverse entstand durch unterschiedliche Urheberrechtsgesetze in den USA und Deutschland. Nach deutschem Recht bleiben Urheberrechte noch 70 Jahre nach dem Tod eines Autors bestehen, während US-Recht diese Werke bereits als gemeinfrei betrachtete. Obwohl nur wenige Werke davon betroffen waren, sperrte der Verein aus den USA alle IP-Adressen aus dem deutschsprachigen Raum gemäß dem deutschen Gerichtsurteil. Die Verhältnismäßigkeit dieser Maßnahme ist diskutabel, jedoch wird dies in der Gerichtsentscheidung kaum erwähnt werden. Längst ist das Urheberrecht in der physischen Welt angekommen.
“Reparaturen sind lästig und nicht selten teuer”
„Reparaturen sind lästig und nicht selten teuer. Wer etwa den Bildschirm eines iPhone 7 austauschen möchte und nicht das Garantieprogramm AppleCare+ abgeschlossen hat, bezahlt bei Apple gut 150 Euro. Etwas günstiger ist es vermutlich im Handyshop um die Ecke, doch der ist möglicherweise kein autorisierter Partner. Das Display selbst auszutauschen, ist am günstigsten. Doch das erfordert nicht nur die entsprechenden Ersatzteile, die Apple nicht offiziell verkauft, sondern auch handwerkliches Geschick. Zudem geht dabei der Garantieanspruch flöten. Ähnlich sieht es bei anderen Herstellern aus, nicht nur von Smartphones, sondern auch anderer elektronischer Geräte. Kritiker bemängeln seit Jahren, dass die Hersteller Reparaturmonopole aufgebaut haben: Indem sie den Verkauf offizieller Ersatzteile unterbinden, nur autorisierten Händlern die Reparatur erlauben und gleichzeitig die Produkte immer schwieriger zu reparieren sind, verdienen sie häufig noch lange nach dem Verkauf an den Geräten.“
“Handyshop um die Ecke, doch der ist möglicherweise kein autorisierter Partner”
Kritiker kritisieren seit langem, dass die Hersteller ein Reparaturmonopol geschaffen haben. Durch das Verhindern des Verkaufs offizieller Ersatzteile, das Erlauben der Reparatur nur durch autorisierte Händler und die zunehmende Schwierigkeit bei der Reparatur verdienen sie oft auch lange Zeit nach dem Verkauf an den Geräten. Viele Elektrogeräte könnten also noch repariert werden, landen jedoch stattdessen auf dem Müll.
“Viele Elektrogeräte könnten repariert werden, doch stattdessen landen sie auf dem Müll”
„Viele Elektrogeräte könnten repariert werden, doch stattdessen landen sie auf dem Müll. Verbraucherschützer fordern daher, ein Recht auf Reparatur von Waschmaschine und Co. im Gesetz zu verankern. … 74 Prozent der Bundesbürger entscheiden sich für die Anschaffung eines neuen Elektrogeräts, weil die Reparatur des defekten Geräts zu teuer gewesen wäre.“
“Anschaffung eines neuen Elektrogeräts, weil die Reparatur des defekten Geräts zu teuer gewesen”
Nichtsdestotrotz geht es in manchen Fällen nicht einmal mehr um die Reparatur von Geräten, sondern bisweilen um ganz andere Gründe.
“Er kappte die Serververbindung der App des Kritikers und machte so dessen Bedienungstool unbrauchbar”
“Der amerikanische Entwickler eines smarten Garagentoröffners machte nach einer derben Kundenkritik im Internet kurzen Prozess: Er kappte die Serververbindung der App des Kritikers und machte so dessen Bedienungstool unbrauchbar.”
“derben Kundenkritik im Internet kurzen Prozess” – “Bedienungstool unbrauchbar”
Selbst als Eigentümer einer physischen Sache, ist man mehr und mehr den Hersteller ausgeliefert. Das Problem zieht sich sogar bis ins Militär hinein. Das Kampfflugzeug F-35 wird in alle Welt verkauft, aber es bleibt ein amerikanisches Flugzeug. Die Software – insbesondere das Feuerleitsystem – bleibt unter amerikanischer Rigide. Allerdings so neu ist das Problem wiederrum auch nicht: Schon während des Falklandkrieges im Jahr 1982, gab es Gerüchte, dass die Franzosen den Briten Deaktivierungscodes für die argentinischen Exocet-Raketen gegeben haben – um die Seeflugzielkörper des Gegners unbrauchbar zu machen. Die Raketen stammten aus französischer Produktion. Ob das stimmt – sei dahingestellt. Allerdings brannte die getroffene RFA Sir Galahad nur aus, ohne dass der eigentliche Sprengkörper explodierte. Das Feuer verursachte der noch aktive Raketenantrieb der Exocet-Rakete, als er in das Schiff einschlug. Das alles kann auch nur Zufall gewesen sein: Denn Blindgänger gibt es heute, wie damals. Jedoch aus strategischer Sicht, würden heimliche Hintertüren in der Software durchaus Sinn ergeben.