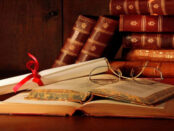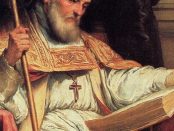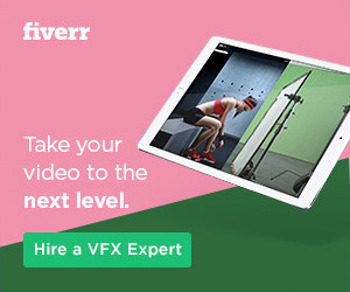Warum der Dreißigjährige Krieg aus gegenwärtiger Perspektive als derart schwer verständlich gilt?
 Screenshot youtube.com
Screenshot youtube.com
Gegen Ende des 16. Jahrhunderts entflammten im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation die religiösen Gegensätze zwischen Lutheranern und Katholiken erneut, obwohl mit dem Augsburger Religionsfrieden von 1555 eigentlich ein Frieden erzielt worden war. Im Jahr 1608 gründete Kurfürst Friedrich V. von der Pfalz die »Protestantische Liga«, während Herzog Maximilian von Bayern im Jahr darauf die »Katholische Liga« ins Leben rief. Das Heilige Römische Reich war, im Gegensatz zu Frankreich, nicht zentralistisch organisiert, sondern bestand aus über dreihundert einzelnen Territorien – und das inmitten eines Europas, das als konfliktträchtiges Machtzentrum galt.
Die Kaiser, die von den Kurfürsten gewählt wurden – fast ausnahmslos Angehörige des Hauses Habsburg – strebten danach, möglichst viel Macht direkt und allein auszuüben. Dies versuchten jedoch zahlreiche Reichsgebiete zu verhindern, darunter die Schweiz, Norditalien sowie die heutigen Gebiete Belgiens und der Niederlande. Die Habsburger herrschten zudem über Spanien, Süditalien, Böhmen und Ungarn. Somit blieb Frankreich ab dem frühen 16. Jahrhundert nur eine Außengrenze und ein Gegner: die Habsburger.
Nach einer angeblichen Verletzung des »Majestätsbriefes«, der den Protestanten in Böhmen Religionsfreiheit gewährte, kam es am 23. Mai 1618 zu einem dramatischen Ereignis: Eine Gruppe von Verschwörern unter Führung des aufgebrachten Heinrich Matthias Thum (1567–1640) warf die beiden verhassten kaiserlichen Statthalter Jaroslav Martinitz und Wilhelm Slavata sowie deren Sekretär Fabicius aus den Fenstern der Prager Burg (Hradschin) in einer Höhe von etwa 17 Metern – der sogenannte Prager Fenstersturz wurde zum Symbol für den offenen Aufstand der böhmischen Stände gegen das Haus Habsburg. Als sichtbares Zeichen erhoben sie den Führer der »Protestantischen Union«, Kurfürst Friedrich V., Schwiegersohn von Jakob I. von England, zum König von Böhmen. Der »Böhmische Krieg« (1618–1620) mündete anschließend in den »Pfälzischen Krieg« (1621–1624). Während des böhmischen Krieges schloss sich dem katholischen Heerführer Johannes von Tilly ein konvertierter böhmischer Edelmann an: Albrecht von Wallenstein (1583–1634). Nach Leopold von Ranke trat mit Wallenstein eine der »außerordentlichsten Gestalten« des Dreißigjährigen Krieges hervor.
Der Kaiser nahm dessen Angebot an, ein privates Söldnerheer aufzustellen. Damit begann laut Gombrich ein »grässliches Gemetzel von schlechtbezahlten, wilden Soldatenhorden«, die vor allem auf Raub und Plünderung aus waren und je nach Aussicht auf Beute die Seiten wechselten. Kaiser und Glaube traten dabei in den Hintergrund. Auch heute, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, erlebt diese Art der Kriegsführung eine Renaissance: So setzen beispielsweise die USA private Söldnerarmeen ein, die ähnlich wie einst Wallensteins Truppen oft rechtlos agieren. Staatliche Souveränität wird so zur Herrschaft des Stärkeren verzerrt.
1628 erhielt Wallenstein das eroberte Mecklenburg als Reichslehen sowie den Titel »General der gesamten kaiserlichen Schiffsflotte zu Wasser wie auch auf dem ozeanischen und baltischen Meer«. König Gustav II. Adolf von Schweden befürchtete nun, dass der habsburgische Kaiser beabsichtigte, an Nord- und Ostsee eine Seemacht aufzubauen. Gleichzeitig sah er seine Gelegenheit gekommen, hegemoniale Ansprüche in Nordosteuropa durchzusetzen. Anfang Juli 1630 landete er mit einer starken Armee auf Usedom und zwang Pommern, Mecklenburg, Brandenburg sowie Sachsen zum Abschluss eines Bündnisvertrages. Ähnlich wie heutige Interventionen oft als humanitäre Rettungsaktionen dargestellt werden, stilisierte Gustav Adolf seinen Krieg als Verteidigung des deutschen Protestantismus – zudem ließ er sich vom katholischen Frankreich dafür bezahlen.
In den Augen Richelieus war er als Vorhut auf deutschem Boden ein willkommenes Instrument gegen das Haus Österreich. Gestern wie heute gilt: Machtpolitik kennt keine Moral. Die enge Verbindung Gustav Adolfs zu Frankreich, wo Kardinal Richelieu bereits zielgerichtet auf die Schwächung der katholischen Habsburger hinarbeitete, sicherte ihm durch den Bündnisvertrag von Bärwalde am 23. Januar 1631 jährlich eine Million Livres beziehungsweise 400 000 Reichstaler französischer Unterstützung und ermöglichte ihm so einen Offensivkrieg »zur Wiederherstellung der unterdrückten Reichsstände im Reich«.
Nachdem 1635 sowohl protestantische als auch katholische Reichsfürsten Frieden mit Ferdinand II. geschlossen hatten, griff Frankreich den habsburgischen Kaiser und dessen spanische Verwandtschaft aktiv an, um die Umklammerung Frankreichs zu durchbrechen und gleichzeitig strategisch wichtige Gebiete für sich zu gewinnen. Für das Heilige Römische Reich entwickelte sich der folgende Krieg gegen das katholische Frankreich und das protestantische Schweden (1635–1648) zu einer Zerreißprobe: Ausgehend von einem lokalen protestantisch-katholischen Konflikt in Böhmen entwickelte sich ein Kampf zwischen zwei katholischen Machtblöcken – den spanischen und österreichischen Habsburgern einerseits sowie Frankreich andererseits. Letztlich ging es also nicht um Glaubensstreitigkeiten; diese wurden lediglich aus machtpolitischen Gründen instrumentalisiert – ähnlich wie heute die gefährlich geschürten Glaubenskonflikte zwischen Schiiten und Sunniten durch die USA.
Die wechselvollen Ereignisse des Dreißigjährigen Krieges, in dem Deutschland aufgrund seiner geographischen Lage zur Bühne europäischer Mächte wurde, fanden am 24. Oktober 1648 ihr Ende im »Westfälischen Frieden«. Dieser präzisierte den Augsburger Religionsfrieden von 1555 und erkannte alle christlichen Konfessionen als gleichberechtigt an. Noch bedeutsamer erwies sich jedoch die veränderte Machtverteilung in Europa – verbunden mit einer neuen Landkarte: Die Schweiz und die Niederlande wurden unabhängig, Schweden stieg gemeinsam mit Frankreich zur Großmacht auf. Die protestantische Ostseemacht erhielt Vorpommern mit Stettin an der Odermündung, Rügen, Wismar sowie das Erzbistum Bremen und Stift Verden an Elbe und Weser. Das katholische Frankreich erhielt zahlreiche deutsche Festungen und Städte nahe dem Rhein und ging somit als eigentlicher Sieger hervor. In den österreichischen Erblanden wurde der Protestantismus nahezu vollständig ausgerottet; gleichzeitig wurde die Machtstellung des Hauses Habsburg geschwächt und weite Gebiete verwüstet.
Für Richelieus Nachfolger Giulio Mazzarino (1602–1661) bedeutete dieser Frieden zunächst einen Triumph über Österreich sowie eine Schwächung des Heiligen Römischen Reiches. Frankreich konnte sich fortan als Garanten der Reichsverfassung jederzeit formal einmischen. Durch diese sogenannte »Pax Gallica« mit erheblichen territorialen Zugewinnen – darunter Ober- und Niedereisass im Elsass, der Sundgau, zehn elsässische Reichsstädte sowie die endgültige Bestätigung der lothringischen Bistümer Metz, Toul und Verdun sowie Besatzungsrechte im rechtsrheinischen Gebiet Philippsburgs und Breisach – rückte eine Einheit der deutschen Länder in weite Ferne.
Im machtlosen Deutschen Reich übernahmen nun die Landesfürsten zunehmend Verantwortung für eine neue Entwicklung hin zum Nationalstaat trotz fortbestehender Kleinstaaterei. Der Kaisertitel verlor weitgehend an Bedeutung; auch wenn ihn die Habsburger bis 1806 weiterführten, stellte er kaum mehr als einen Ehrentitel dar. Mit der Unabhängigkeit der Niederlande sowie dem Verlust wichtiger Küstenregionen und Ostseehäfen an Schweden war Deutschland nahezu vollständig vom Seehandel abgeschnitten; Kolonialerwerbungen wurden dadurch erschwert oder unmöglich gemacht – was zu einem Bedeutungsverlust führte. England, Schweden, Spanien und die Niederlande hingegen gewannen durch ihre erfolgreiche Kolonialpolitik erheblichen Einfluss und Wohlstand; zudem forderten sie ein liberales Bürgertum heraus – eine gesellschaftliche Entwicklung, die in den deutschen Ländern nicht Fuß fassen konnte.
Der kriegsbedingte wirtschaftliche Zusammenbruch führte in Deutschland zu einer Verwilderung gesellschaftlicher Strukturen. Die Bevölkerung sank um etwa ein Drittel von rund 19 auf etwa 12 Millionen Menschen; viele starben vermutlich an Hunger oder vor allem an Seuchen. Der schwedische General Johan Baner schrieb 1638: »Vom äußersten Pommern bis zur Elbe sind alle Länder so verwüstet und geplündert worden, dass weder Hund noch Katze noch Menschen oder Pferde dort verweilen können.« Die über eine Generation andauernden Zerstörungen hinterließen tiefe Spuren im kollektiven Gedächtnis der Deutschen.
In Frankreich wurde Ludwig XIV., damals erst vier Jahre alt, im Jahr 1643 zum König gekrönt; während seiner Minderjährigkeit regierte Kardinal Mazzarino stellvertretend für ihn. Der spätere Sonnenkönig herrschte insgesamt 72 Jahre lang bis zu seinem Tod im Jahr 1715. Sichtbares Symbol seines Absolutismus ist unter anderem das Schloss Versailles. Als zentrales Machtinstrument baute er sich ein stehendes Heer auf; Kriegsminister Louvois organisierte dieses zukunftsweisend nach Infanterie-, Kavallerie- und Artillerieeinheiten in Kompanien, Regimenter und Brigaden gegliedert. Mit einer damaligen Truppenstärke von rund 270 000 Mann bei einer Bevölkerung von etwa 18 Millionen unterstrich Ludwig XIV. seinen ausgeprägten Machtanspruch eindrucksvoll. Der Sonnenkönig festigte Frankreichs Vormachtstellung weiter durch zahlreiche Eroberungskriege.
Im Friedensvertrag von Nimwegen (1678) verständigte sich Frankreich mit Holland, Spanien und dem deutschen Kaiser auf territoriale Regelungen: Burgund, Cambrai, Valenciennes, Freiburg sowie Lothringen wurden französisch – dadurch verschob sich Frankreichs Grenze nach Norden sowie vor allem nach Osten am Oberrhein deutlich vorwärts. Ludwig XIV., nun mächtigster Herrscher Europas, setzte seine Eroberungspolitik auch im Frieden fort: Um weiter nach Osten expandieren zu können berief er sich auf ein umstrittenes Wiedervereinigungsrecht (Reunionsrecht) und erhob territoriale Ansprüche bis zurück zur Merowingerzeit – jener Dynastie salischer Franken zwischen 486 und 751 n.Chr..
Da der deutsche Kaiser aufgrund innerer Unruhen in Ungarn sowie drohender türkischer Angriffe – letztere wurden durch Ludwig XIV.s Unterstützung gefördert – keine militärische Hilfe leisten konnte, gingen Elsass und große Teile der Pfalz kampflos verloren. Ein besonders fragwürdiger Höhepunkt dieser Reunionspolitik war am 30. September 1681 die Besetzung sowie Annexion der freien Reichsstadt Straßburg; dies stieß selbst in benachbarten westeuropäischen Staaten auf Empörung.
Im Gegensatz dazu hatte das Osmanische Reich vermutlich aufgrund vielfältiger innerer Probleme während des Dreißigjährigen Krieges seine Chancen ungenutzt verstreichen lassen. Erst um 1660 wurde die türkische Bedrohung für das habsburgische Reich akut, als es versuchte Siebenbürgen zu unterwerfen; zugleich erschwerten Kämpfe Kaiser Leopolds I., insbesondere gegen Ludwig XIV., welcher mit den Türken verbündet war, deren Abwehr.
Die kriegerische Zuspitzung in Ungarn führte schließlich im Jahr 1683 zum letzten großen Vorstoß des osmanischen Heeres: Unter dem Kommando des Großwesirs Kara Mustafa begann ab dem 14. Juli die zweite Belagerung Wiens – exakt 157 Jahre nach dem ersten erfolglosen Versuch im Jahr 1526.
Anschließend richteten sich die türkischen Angriffe gegen das mittelalterliche Königreich Ungarn; noch im selben Jahr wurde es nach einem erbitterten Kampf in der Schlacht bei Mohács vernichtet. Trotz stetiger Verstärkung seit der Vereinigung mit Böhmen im Jahr 1490 erwiesen sich die ungarischen Streitkräfte als zu schwach gegen die türkische Übermacht; Mohács markierte somit das Ende ihrer Widerstandsfähigkeit gegen die türkische Expansionenflut.
Der britische Geschichtsphilosoph Arnold J. Toynbee betonte jedoch gerade angesichts dieser vernichtenden Niederlage neue Gegenkräfte: »Sie schlossen sich unter den Habsburgern zusammen, welche seit dem Jahr 1440 in Österreich herrschten; diese Verbindung bestand fast vierhundert Jahre lang bis zum Jahr 1918 – jenem Jahr also, in dem auch das Osmanische Reich endgültig zerfiel –, jenes Reich nämlich welches vor vierhundert Jahren mit seinem Angriff bei Mohács diesen entscheidenden Hammerschlag ausgeführt hatte.«
Während Wien verteidigt werden konnte, gelang es am 12. September 1683 deutschen sowie polnischen Truppen unter Führung des polnischen Königs Johann III Sobieski vom Kahlenberg aus den Belagerungsring aufzubrechen und damit eine Vernichtung der osmanischen Truppen einzuleiten.
In dieser Zeit zeichnete sich Prinz Eugen von Savoyen (1663–1736) als herausragender Feldherr aus: Obwohl Ludwig XIV., aufgrund seines unscheinbaren Äußeren zunächst ablehnte ihn als Offizier aufzunehmen, befreite Eugen in den folgenden Jahren zahlreiche Länder von türkischer Herrschaft: Budapest fiel bereits 1686 zurück ins habsburgische Herrschaftsgebiet; Siebenbürgen wurde ein Jahr später befreit; schließlich standen habsburgische Truppen bereits ein Jahr darauf vor Belgrad.
Die türkische Grenze wurde somit von ihrem Verlauf entlang Wiens südöstlicher Vororte zwischen 1529 bis zur Belagerung von 1683 zurück bis an die nordwestlichen Vororte Adrianopels (heutiges Edirne), etwa 220 Kilometer westlich von Istanbul gelegen, zurückgedrängt.
Parallel kämpften Polen sowie Russland gegen das Osmanische Reich und entrissen ihm im Jahr 1696 Asow am Schwarzen Meer. Im Frieden von Karlowitz gingen Ungarn, Siebenbürgen Kroatien sowie große Teile Slawoniens an Österreich über. Nach der Befreiung Wiens verfügten Kaiser sowie das Reich – darunter Bayern, Brandenburg Hannover und Sachsen – über genügend Kräfte um zunächst allein gegen Frankreich vorzugehen.
Ludwigs Versuch jedoch auch Kurpfalz einzunehmen scheiterte am entschlossenen Eingreifen Wilhelms III., seit 1689 König von England. Dieser organisierte als Gegner französischer Expansionspolitik ein starkes Bündnis zur Wahrung eines europäischen Gleichgewichts. Neben Kaiser samt Reich traten Holland England Schweden sowie ab 1690 Spanien und Savoyen diesem Bündnis bei.
Nach drei Jahren stand Frankreich kurz vor einer Niederlage; dennoch zeigte auch diese Große Allianz Ermüdungserscheinungen. Mit diplomatischer Geschicklichkeit gelang es Ludwig XIV., die Koalitionsparteien gegeneinander auszuspielen. Die Allianz zerbrach schließlich; schwerwiegende Kriegsschäden für Frankreich konnten so abgewendet werden. Im Friedensvertrag von Ryswick (1697) musste Frankreich alle eroberten Gebiete bis auf Elsass zurückgeben.
Doch auch dieser Friede bedeutete keine dauerhafte Ruhe für Europa; vielmehr eröffnete er nur eine vierjährige Atempause. Als schließlich Karl II., spanischer König ohne Nachkommen starb (1.November1700), erlosch Spaniens habsburgische Linie. Während Ludwig XIV., für seinen Enkel Philipp von Anjou Erbansprüche anmeldete sah William III., englischer König große Gefahr für das europäische Mächtegleichgewicht («Balance of Power»). Er formierte geschickt eine breite Koalition zur Verteidigung Europas “Freiheit” bestehend aus England, Holland, Österreich, Preußen, Hannover, Portugal und Heiligem Römischem Reich, sowie Savoyen. Einzig Bayern blieb Verbündeter Ludwigs XIV.. William III erreichte damit sein Ziel doch verstarb noch bevor er aktiv in den Krieg eingreifen konnte an Verletzungen eines Pferdesturzes.
Daraufhin musste zunächst Englands Thronfolge geklärt werden: Wahl fiel auf Anne zweite Tochter Karls II.. Sie war streng anglikanisch erzogen worden hatte sich während Glorious Revolution auf Seite Wilhelms gestellt was Kontinuität für Parlament bedeutete. Um weitere Verwirrung zu vermeiden erhob Kaiser Leopold I eigene Erbansprüche auf Spanien für seinen Zweitgeborenen Erzherzog Karl gegen französisches Vorgehen. Ein kaiserliches Heer unter Prinz Eugen marschierte nach Italien los womit erster moderner Weltkrieg begann mit Kampfhandlungen in Spanien Italien Süddeutschland Niederlanden Ozeanen Nordsee. Die Allianz errang Sieg um Sieg Österreich wurde Englands «Festlandsdegen» fast fünfzig Jahre lang doch konnte es lebenswichtige Seestraße Gibraltar sichern?
Spanien drohte Sperrung doch konnte sie nicht durchsetzen während spanischer Kommandant Gibraltar Verstärkung ersuchte was glücklicherweise erfolglos blieb. Anfang August 1704 nahmen hessisch-österreichische Truppen Landgraf Georg von Hessen-Darmstadt Gibraltar ein Flaggen wehten nun habsburgisch-hessisch symbolisierten Besitz rechtmäßigen spanischen Thronfolgers. Als Truppen abgezogen wurden hisste englischer Admiral Sir George Rooke erneut englische Flagge Versuche Spanier Franzosen Rückeroberung scheiterten kläglich.
Im Frieden von Utrecht 1713 gelang diplomatischer Coup Spanien wurde zwischen Philipp Anjou Enkel Ludwigs XIV sowie Kaiser Karl VI geteilt Holland erhielt Kontrolle über spanisch-niederländische Grenzbefestigungen Preußen Obergeldern Grafschaften Mörs Lingen England Hudsonbay-Länder Neufundland Neuschottland Spanien musste Gibraltar Menorca an England abtreten zudem erkannte Frankreich preußischen Königstitel protestantische Thronfolge Englands an versprach Dünkirchen Festungswälle schleifen Diese Zugeständnisse hatten weitreichende Folgen: Engländern öffneten sich kanadische Wälder für Pelzjäger endgültiger Ausschluss Frankreichs aus Nordsee Kaufleute sicherten Sklavenhandel zwischen Westafrika Westindien Theologe Dichter James Thomson verfasste dankbar englisches Nationallied «Rule Britannia Britannia rule the waves».
Es scheint als stünden Friedenserfolge oft im umgekehrten Verhältnis zum Kriegseinsatz: Für Britannien kämpften lediglich rund 18 000 Mann Niederlande 90 000 Österreich 100 000 Soldaten. Im Frieden von Rastatt Baden bestätigte Kaiser Karl VI 1714 Utrechter Vereinbarungen nahm ihm zugedachte Gebiete entgegen britischer Sieg vollends Gleichgewichtspolitik erfolgreich umgesetzt Großbritannien avancierte «Schiedsrichter» eines wirtschaftlich geprägten Krieges worauf Sir John Seely bemerkte «the most businesslike of all our wars». Königin Anne gelang es 1707 Personalunion England-Schottland zur Realunion «Großbritannien» umzuwandeln gestärkt richtete man Blick gen Atlantik.