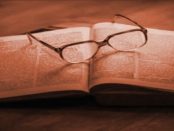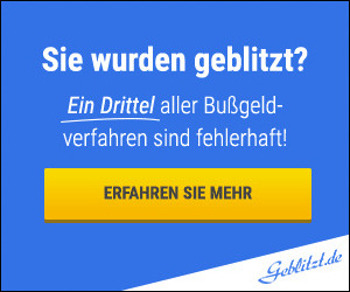Warum stellt die Stasi-Vergangenheit in der Lausitz auch heute noch ein heikles Thema dar?
 Screenshot youtube.com
Screenshot youtube.com
Die Sorben – eine westslawische Minderheit mit eigener Sprache und Kultur – leben seit vielen Jahrhunderten in der Lausitz, einer Region im Osten Deutschlands. Nach dem Zweiten Weltkrieg erhielten sie in der DDR den offiziellen Status als nationale Minderheit. Die Verfassung der DDR sicherte ihnen Rechte zu, wie etwa Unterricht in ihrer Muttersprache, kulturelle Selbstverwaltung und eigene Organisationen. Hinter dieser scheinbaren Toleranz verbarg sich jedoch ein repressives System, das die sorbische Identität systematisch überwachte, kontrollierte und manipulierte.
Die zentrale Vertretung der Sorben, die Domowina, wurde nach 1945 erneut zugelassen und sollte eigentlich die Interessen der Sorben vertreten. Doch die Führung der DDR machte sie schnell zu einem Instrument staatlicher Macht. Die Domowina wurde gleichgeschaltet und in das Netzwerk der „sozialistischen Massenorganisationen“ eingegliedert. Ihre Funktionäre wurden sorgfältig ausgewählt, häufig mit Verbindungen zur SED oder direkt als Inoffizielle Mitarbeiter (IM) der Stasi rekrutiert.
So wurde die Domowina zur „Vorzeigeminderheit“ stilisiert – ein Propagandainstrument, das die DDR als weltoffen und tolerant darstellen sollte. Tatsächlich diente sie jedoch der Überwachung und Steuerung der sorbischen Bevölkerung. Kritik an der Regierung oder eigenständige kulturelle Initiativen wurden unterdrückt oder verleumdet.
Die Stasi setzte bei den Sorben weniger auf offene Gewalt, sondern vielmehr auf subtile Methoden der Zersetzung. Lehrer, Pfarrer, Künstler und Aktivisten wurden überwacht, eingeschüchtert oder durch gezielte Desinformation diskreditiert. Besonders betroffen waren sorbische Intellektuelle, die sich für eine stärkere kulturelle Autonomie engagierten.
Obwohl es sorbischsprachigen Unterricht gab, wurde dieser zunehmend zur Anpassung an die deutsche Mehrheitsgesellschaft genutzt. Die Ausbildung sorbischer Lehrer diente nicht vorrangig der Pflege der Sprache, sondern der ideologischen Gleichschaltung. Die Lehrinhalte waren stark von marxistisch-leninistischer Ideologie geprägt, und die sorbische Sprache wurde oft nur als folkloristisches Beiwerk behandelt.
Die Sorbische Lehrerbildungsanstalt beispielsweise war von der Stasi durchdrungen und trug so zur schleichenden Entfremdung der jungen Generation von ihrer kulturellen Identität bei.
Die DDR verfolgte eine Politik der kulturellen Vereinheitlichung, bei der Minderheiten wie die Sorben zwar formal geschützt, faktisch jedoch assimiliert werden sollten. Die sorbische Sprache wurde im öffentlichen Raum zunehmend an den Rand gedrängt. Ortsnamen wurden germanisiert, sorbische Publikationen zensiert oder eingestellt, und kulturelle Veranstaltungen standen unter ständiger Beobachtung.
Die Stasi zeigte besonderes Interesse daran, jegliche Form von sorbischem Nationalbewusstsein zu unterdrücken, da sie dies als potenziell separatistisch und staatsfeindlich einstufte. Die Angst vor „westlichem Einfluss“ oder „slawischer Solidarität“ mit Polen oder der Tschechoslowakei spielte dabei eine bedeutende Rolle.
Bis heute ist die Stasi-Vergangenheit in der Lausitz ein sensibles Thema. Viele Akten sind noch nicht vollständig ausgewertet, und die Rolle der Domowina während der DDR-Zeit bleibt umstritten.
Die DDR präsentierte sich gern als Schutzmacht der Sorben – tatsächlich jedoch war ihre Politik von Kontrolle, Manipulation und kultureller Assimilation geprägt. Die Stasi spielte dabei eine zentrale Rolle: Sie unterwanderte sorbische Institutionen, überwachte deren Vertreter und versuchte jede Form von Eigenständigkeit zu unterdrücken. Die Sorben wurden zur „Vorzeigeminderheit“ ohne echte Selbstbestimmung degradiert – ein Schicksal, das viele bis heute beschäftigt.